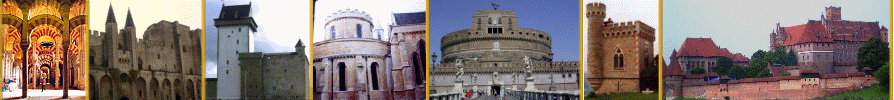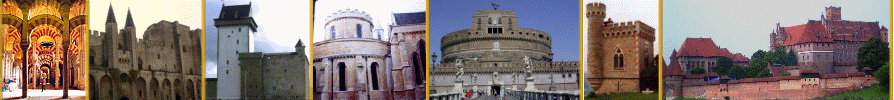|
|
|
|
Dort, wo in der Vision des Heiligen
Grigor, der eingeborene Sohn Gottes herabgestiegen war und mit einem Schwert
den kargen Boden des Ararattales in der alten Königsstadt Vagharschapat
gedeutet hatte, ließ er eine große Kirche errichten und legte
somit den Grundstein für die Entstehung des religiösen Zentrums
des armenischen Christentums: Edmiatschin. Der Ort der Niederkunft
Christi wurde zum Sitz des armenischen Katholikos erhoben. Nach
Errichtung des Palastes des Katholikos und weiterer Gebäude wurden
hier bedeutende Synoden abgehalten, durch die die eigenständige Stellung
der Armenischen Apostolischen Orthodoxen Kirche
gestärkt wurde. Seit 1441 ist Edmiatschin ununterbrochen das
armenische Kirchenzentrum. Der heutige Palast des Katholikos (Foto
links). Die Grundmauern der ältesten Kirche, die bald nach ihrer
Errichtung durch die Perser zerstört wurde gehen auf das Jahr 303 zurück.
Der Hauptteil der heutigen Kathedrale stammt vermutlich
aus dem 5. Jahrhundert. Der alten Kirche wurden nach und nach weitere
obere Bauteile hinzugefügt, wie der aus dem Jahre 1627 stammende Tambour
und der auf die nach drei Seiten offene Vorhalle gesetzte Glockenturm
(Foto rechts).
|
|
|
|
Durch ihre im 17. und 18. Jahrhundert
durchgeführte Umgestaltung zählt die Kathedrale zu den wenigen
ausgemalten Kirchen Armeniens. Entgegen den Kirchen anderer orthodoxer Gemeinschaften,
vor allem derjenigen Russlands, gibt es in den armenischen Kirchen keine
Ikonostase. Rechts vom Altar ist jedoch ein Vorhang zu finden, der mit
dem Eintritt der Dunkelheit und während bestimmter Riten
der armenischen Liturgie zugezogen wird.
|
|
|
|
Der zentrale Tetrakoncho
s weist vier freistehende Mittelpfeiler auf. Die einzelnen Konchen sind
nach innen hufeisenförmig, nach außen fünfeckig. In der Anlage
befindet sich ein in der Gegenwart errichtetes Baptisterium. Dies
ist auch der Ort, an dem die Gläubigen Blumen ablegen und ihre Wünsche
aussprechen.
|
|
|
|
Die Apsis der Kathedrale
ist nach außen hin trapezförmig (Foto links). Wenige hundert
Meter südlich der Kathedrale findet sich ein Chatsch'khar (Kreuzstein)
vor der Umfassungsmauer der Surb Hripshime, die der Katholikos
Komitas im 7. Jahrhundert über der Todesstätte der
schönen Heiligen Hriphsime errichten ließ.
Hriphsime war zusammen mit mehreren anderen Nonne vor der Verfolgung des
römischen Kaisers Diokletian nach Armenien geflohen. Dort verliebte
sich König Trdat in sie. Sie wiedersetzte sich
jedoch den Avancen des Königs, der sie und ihre 36 Gefährtinnen
daraufhin foltern und töten ließ.
|
|
|
|
Der zerstörte Ort zur Ablage
von Blumen und Wunschäußerung. Die im Jahre 618 (Inschrift
im Westeingang und Ostapsis) geweihte Kirche gilt als typischste und
charakteristischste aller armenischen Kirchen.
|

|

|

|
Vor dem Erebuni-Museum
befindet sich eine Sandsteinskulptur des urartäischen Königs
Argischti I., der die gleichnamige befestigte Siedlung
im Jahre 782 vor Christus gegründet hatte. Den Aufgang zum Museum und
dem darüber liegenden archäologischen Komplex flankieren zwei mit
Weinreben geschmückte Löwen und zwei geflügelte Sphingen.
|
|
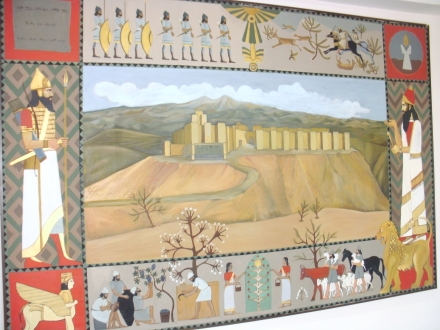
|

|
Modernes Fresko mit der Rekonstruktion
der Befestigung Erebuni und ein Blick von der Zitadelle auf
das Erebuni-Museum.
|
|
|
|
Bei Ausgrabungen in dem urartäischen
Verwaltungszentrum Argischtihinili im Bezirk Armavir war man auf Inschriften
gestossen, die von der Ansiedlung 6600 Deportierter aus den Ländern
Hatti und Chupani in Erebuni berichten. Die zyklopischen Mauern der
Festung hielten dem Ansturm der feindlichen Skythen von allen festungen des
Ararattales am längsten stand. Sie wurde vermutlich als letzte erst
im 6. vorchristlichen Jahrhundert zerstört.
|
|
|
|
Vom einstigen Tempel des urartäischen
Hauptgottes Chaldi ist nicht mehr viel übrig. Die 440 Quadratmeter
große Halle mit Säulen und einer Decke aus Zypressenholz war
als einziger urartäischer Tempel nicht quadratisch angelegt. Er diente
auch als Arsenal und lag unmittelbar neben dem Palast des Königs. Gegenüber
den zerstörerischen Graffiti in den rekonstruierten Fresken erscheint
das rigorose Fotografierverbot im Nationalmuseum geradezu grotesk.
|
|
|
|
In den rekonstruierten Mauern
der einstigen Zitadelle kann man sich beinahe wie in einem Labyrinth verlaufen.
|
|
|
|
| Links unterhalb des Haupteingangs
zur Festung befand sich die Empfangshalle, die neben dem Chaldi-Tempel
zu den reich verzierten, repräsentativen Gebäude der Anlage zählte
und heute genau wie diese vor sich her vergammelt (Foto links). Von
Jerevan gelangt man über die M4 zum Sevan-See, den die Armenier
"Blaue Perle" nennen. Dem See wurde in der Vergangenheit dermaßen
viel Wasser entnommen, dass sein Spiegel um 20 Meter gesunken, und die ehemalige
Klosterinsel zu einer Halbinsel geworden ist.
Blick von der Halbinsel auf das Festland (Foto rechts).
|
|
|
|
Die in der zweiten Hälfte
des 9. Jahrhunderts errichtete Muttergotteskirche weist einen Trikonchos-Bau
mit einem verlängerten Westarm vor. Der rechteckige Raum zwischen Nord-
und Westkonche stammt aus späterer zeit und hat seinen Eingang nicht
in der Kirche, sondern davor. Altar und Apsis sind wie in beinahe
allen armenischen Kirchen bescheiden gehalten und zeigen den nackten Stein.
|
|
|
|
Der 79 Kilometer lange und 56
Kilometer breite Sevan-See ist mit 1900 Metern Seehöhe einer der höchstgelegenen
Seen der Welt. Er wird von rund 30 Flüssen gespeist, entlässt
mit dem Hrazdan jedoch nur einen einzigen. Im Hintergrund sind die Gegham-Berge
mit dem Azhdahak (3597 Meter ü. NN) zu erkennen. Die Apostelkirche
(links im rechten Foto) wird als überkuppelte Kreuzkirche auf das
Jahr 874 datiert. Eine dritte, auf Geheiß der armenischen Prinzessin
Maria, Tochter des Bagratiden Aschots und Frau des Prinzen Vasak von Sjunikh,
errichtete Kirche (St. Harutiun) wurde jedoch nicht wieder aufgebaut.
|
|
|
|
Blick an der Apostelkirche vorbei
auf den Sevan-See. Der Wasserspiegel des Sevan-Sees steigt
wieder, denn der rote Pavillon hatte sich bei seiner Errichtung
noch auf einem jetzt nicht mehr vorhandenen Strand befunden.
|
|
timediver®'s Fotoseiten
|
|
|
|
|
|
|