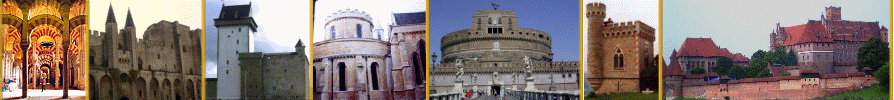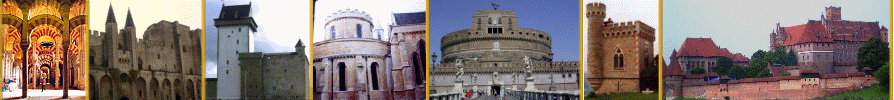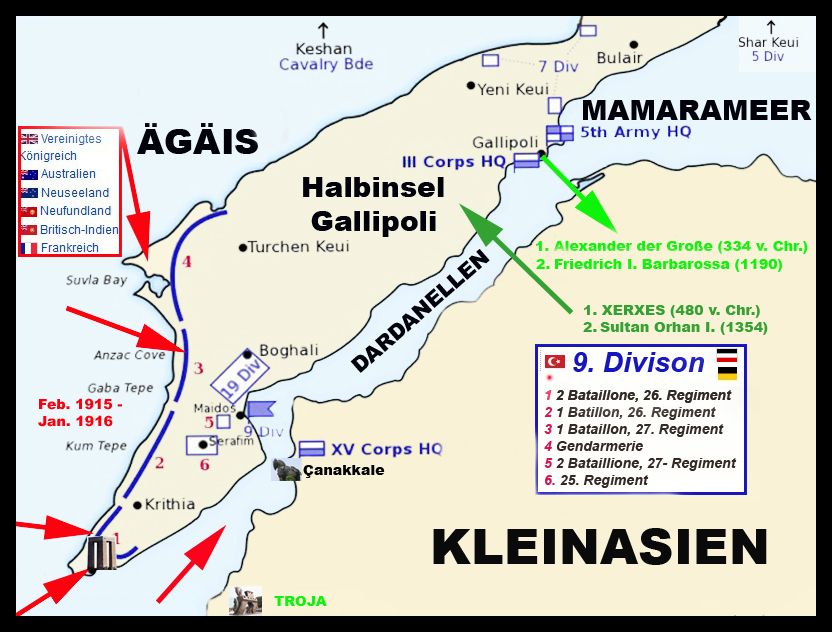
|
 |
|
Die Europa von
Asien trennende
Meeresenge der Dardanellen, im
Altertum Hellespont genannt,
war in
der Geschichte stets von besonderer Bedeutung. Während er von den
Persern von Ost nach West (dunkelgrüner Pfeil) überquert
wurde, nutzten ihn sowohl
Alexander der Große als auch Kaiser Friedrich I. Barbarossa auf
dem
Dritten Kreuzzug, um nach Kleinasien zu gelangen (hellgrüner
Pfeil).
|

|

|
| Von
den türkischen und alliierten
Denkmäler für die Gefallenen ist das Çanakkale Şehitleri Anıtıim
im Gelibolu Yarımadası (Historischen Nationalpark) in der Morto Bay
am Südende der Halbinsel das monumentalste. |

|

|
| Der
persische Großkönig Xerxes ließ 480 v. Chr. auf seinem
Feldzug nach Griechenland aus fünfzigruderigen Galeeren, die an
Bug
und Heck miteinander vertäut und mit mit Planken verbunden waren,
eine Brücke errichten. Nachdem ein Sturm die erste Brücke
zerstört
hatte ließ Xerxes, dem Bericht Herodots zufolge, den Hellespont
mit
dreihundert Geißelhiebe züchtigen. Heute kann man mit die
Dardanellen mit drei Fährverbindungen überqueren: Gelibolu –
Lapseki (Foto links), Ecebat – Canakkale und Kilidibahir –
Canakkale. Die Requisite (Foto rechst) aus dem US-amerikanischer
SpielfilmTroja des
deutschen Regisseurs Wolfgang Petersen mit Brad Pitt und Diane Kruger
(2004) wurde am Ufer der
Provinzhauptstadt Çanakkale aufgestellt. |
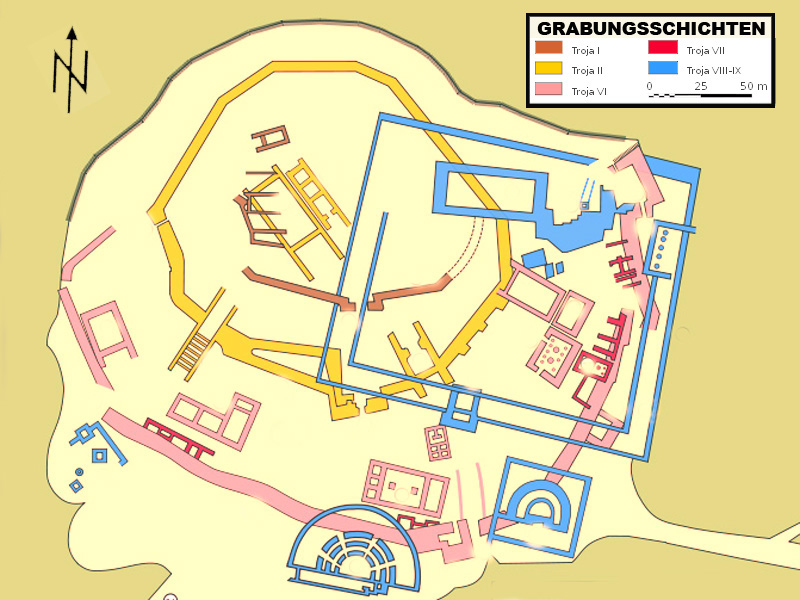 |
 |
| Die
in der antiken Landschaft Troas bei
Dalyan Köyü gelegene
Ausgrabungsstätte liegt ca. 61 Kilometer südwestlich von Çanakkale
und ist von dort in 65 Minuten zu erreichen. Der Hisarlik
(Burghügel)
von Troja birgt jedoch nicht nur die von Homer in seinen Epen
Illias
und Odyssee beschriebene sagenhafte Stadt des „Trojanischen
Krieges“, sondern insgesamt 10
Siedlungsschichten (Troja I bis
Troja X), die wiederum in über 40 Feinschichten unterteilt
werden:
Troja I (2950–2550 v. Chr.) und II (2550–2200) der Frühen, Troja
III bis V (2200–1700) der Mittleren, Troja VI bis VIIa (1700–1200)
der Späten Bronzezeit und Troja VIIb (1200–1000) der Frühen
Eisenzeit an. Troja VIII und IX datieren in die Zeit vom 8.
Jahrhundert v. Chr. bis in die römische Zeit, Troja X, ein
byzantinischer Bischofssitz, reicht bis ins frühe Mittelalter.
|
 |
 |
Der
Mauerturm von Troja
VI (Foto links) und die Ostmauer
(Troja VIII/IX), die einst den äußeren Schutzwall im
Frühmittelalter bildete (Foto rechts).
|
 |
 |
An
der bis zu vier Meter hohen geböschten Ostmauer entlang
(grüner Pfeil) gelangt man zur einstigen Nordbastion von Troja VI., das man
sich wie auf der Abbildung oben rechts vorstellen kann.
|
 |
 |
Die
Reste des gepflasteren Weges (Foto links) liegen oberhalb der
Nordbastion und gehören zur frühmittelalterlichen
Siedlungsschicht von Troja XIII/IX. Nach wenigen Metern erreicht
man den einstigen Tempel der Athena,
dessen Anfänge in die archaische Zeit zurückreichen. Der
persische Großkönig Xerxes brachte hier im Jahre 480 v. Chr.
vor der Seeschlacht
von Salamis ein Opfer dar. Für die Plattform, des unter
Lysimachos (361/360 - 281 v. Chr) und erneut unter dem römischen
Kaiser Augustus erneuerten heiligtums, wurde der Residenzbereich von
Troja VI und VII komplett abgetragen. Durch die Ausgrabungsarbeiten
Heinrich Schliemanns (1822 - 1890) und weitere Dilettantismen wurde
wiederum große Teile dieser Bausubstanz zerstört. Die Steine
mit den Kassetten (Foto rechts) ....
|

|
 |
|
....und
die den Pflanzen-, bzw. Tiermustern sind letzte Zeugen des einstigen
Athena-Tempels. Die rekonstruierte
Mauer von Troja I (Foto rechts).
|
 |
 |
Unter
einem Zelt oberhalb der Mauer befinden sich die aus Lehmziegeln
errichteten und rekonstruierten Türme, Burgmauern......
|

|
 |
| ...und
Residenzhäuser von Troja II./III... Mauer und Türme von
oben (Foto links) und der Seite (Foto rechts) aus gesehen). |
 |
 |
Bereits
die ältesten Residenzhäuser entsprachen mit ihrer
flachdachgedeckten länglichen Halle und einer offenen Vorhalle
bereits dem
Megaron, aus dem sich der spätere Anten- und auch
größere Tempel
entwickeln sollten. Um die Grabungen herum gelangt man wieder an
die Mauer von Troja I (Foto rechts).
|
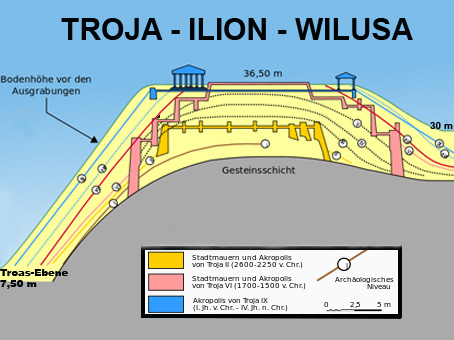 |
 |
| Der
Querschnitt durch den Hisarlik (Foto
links) und eine Stelle an
der die einzelnen Schichten markiert wurden (Foto rechts). Troja
(türk.: Truva) wurde von seinen Bewohnern als Ilios oder Ilion,
von
den Hethitern als Wilusa bezeichnet. |
 |
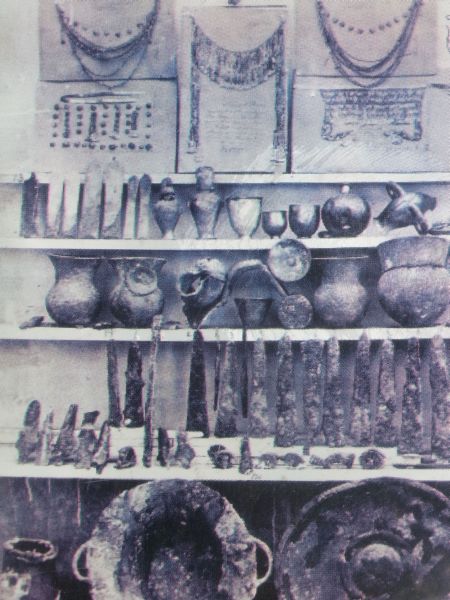 |
Der
bis zu 15 Meter tiefe Zugschnitt, den Schliemann 1893 ohne
Rücksicht auf Verluste durch die Schichten von Troja I. und II.
anlegen ließ (Schliemanngraben;
Foto links) führte schließlich am 31. Mai 1873
zum Auffinden eines Schatzes. Schliemann, der an der Fundstelle das "Skäische Tor" Homers vermutete
hatte, jedoch nicht wie er glaubte, den
Schatz des Priamos entdeckt. Die Artefakte (Foto rechts) stammen
vielmehr aus einer Zeit, die 1500 Jahre vor dem "Trojanischen Krieg" lag, der
angeblich zwischen dem 13. und 12. vorchristlichen Jahrhundert
stattgefunden hatte. Schliemann schmuggelte seinen Fund an den
Osmanischen Behörden vorbei nach Deutschland, wo er ihn 1981 dem
"Deutschen Volk zum Geschenk" machte. Von der Roten Armee wurde
der Schatz 1945 als Beutekunst
in die Sowjetunion gebracht. Bis heute streiten Russland, Deutschland
und die Türkei darum, wer der rechtmäßige
Eigentümer der Preziosen sei. Daneben streiten sich die in zwei
Lager gespalteten Historiker darüber, ob die Sage vom Trojanischen
Krieg einen historischen Kern besitzt. Von den Befürwortern
werden die Zerstörungsspuren an den Fundamenten von Troja VI als
Zeugnis von Homers Schilderungen ins Feld geführt.
|
 |
 |
Neben
dem Schliemanngraben führt eine gepflasterte, 21 Meter
langen Rampe zum einstigen Palast Troja VI hinauf.
|
 |
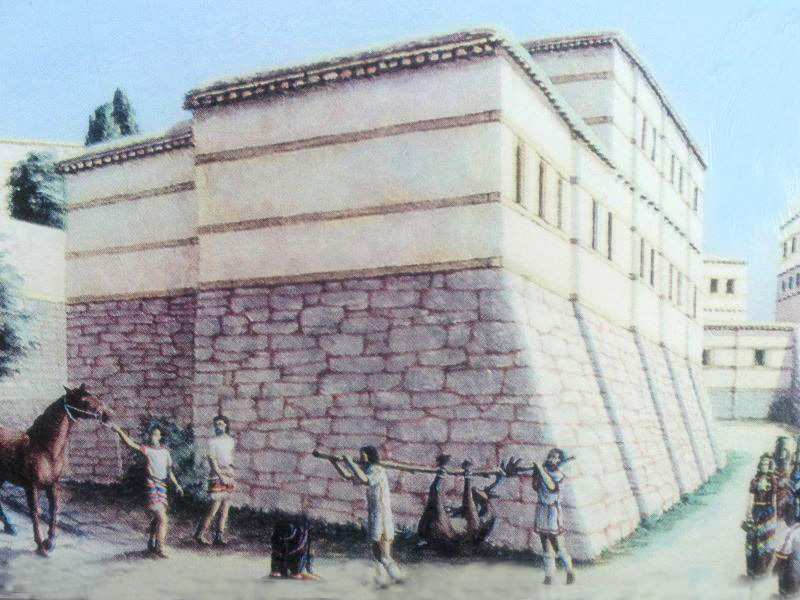 |
Südlich
der Rampe findet man die Mauern des Hauses VI M (Foto links), in dem
man ein Vorratslager (Foto rechts) des Palastes Troja VI vermutete.
|
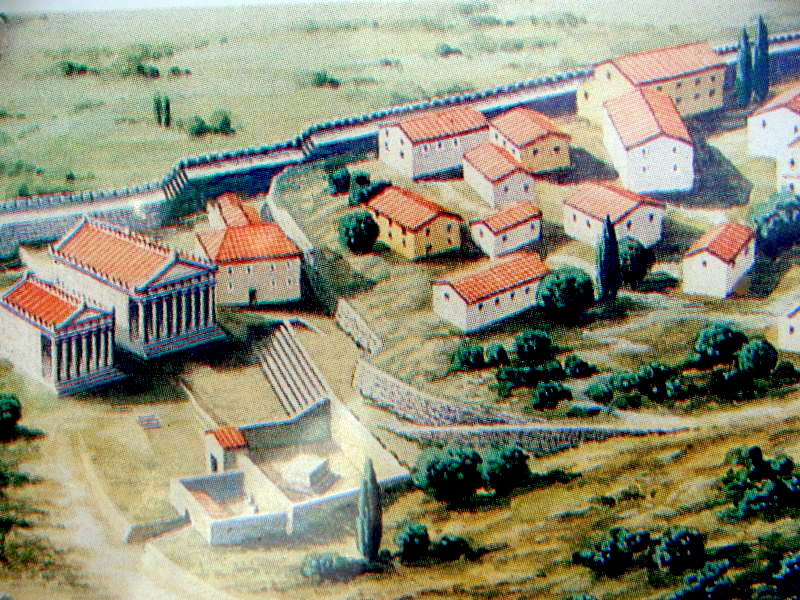 |
 |
Weiter
südlich davon gelangt man zu den Resten einer Siedlung von Troja
VIII/IX (im linken Bild rechts und Foto links)...
|
 |
 |
...an
die sich ein, im 8. Jahrhundert angelegter Heiliger Bezirk mit zwei Tempeln (im
linken Bild oben links) anschloß und dessen Altar (grünes A) bis in die
römische Zeit hinein benutzt wurde.
|
 |
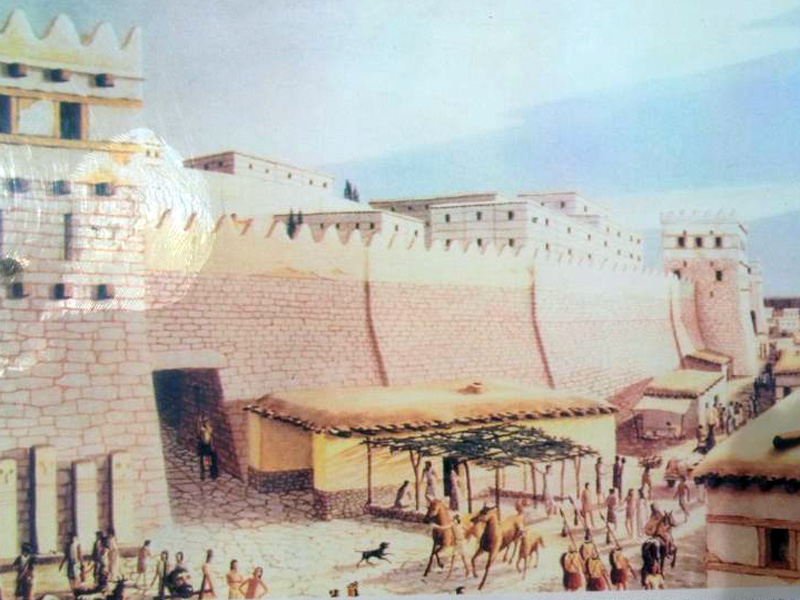 |
Das
Südtor von
Troja VI, an dem in römischer Zeit ein gepflasteter Torweg
(Foto links) zum Propylon des Athena-Temples führte, wurde einst
von einem dreistöckigen Turm
flankiert (Foto rechts).
|
 |
 |
Bevor
der Rundgang durch die Ausgrabungsstätte endet, kommt
man noch am den Ruinen eines Bouleuerions
(Versammlungshauses) und Odeions (Theaters)
von Troja VIII./IX.. vorbei (Foto links). Im Pithoi-Garten wurden antike
Wasserleitungen und Vorratsgefäße platziert (Foto rechts).
|
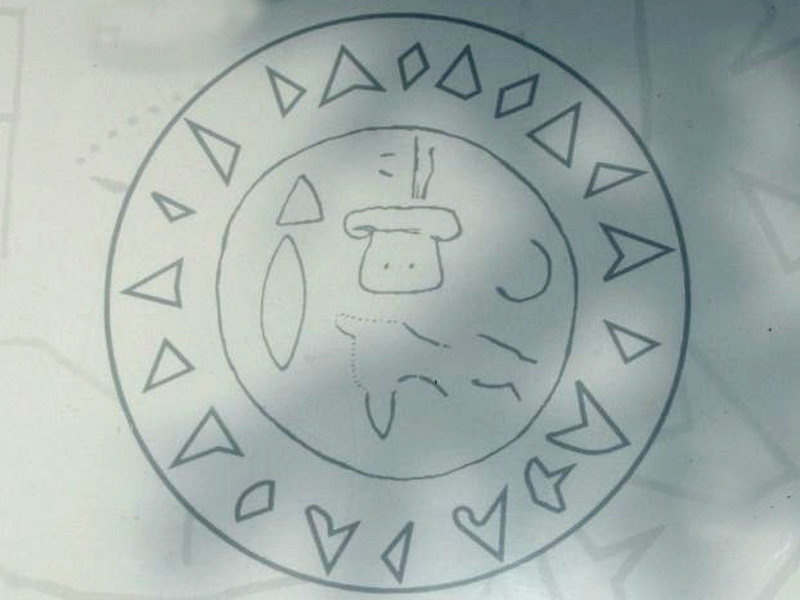 |
 |
Neben
den luwischen Hieroglyphen auf dem 1995
gefundenen,
bikonvexen Bronzesiegel (Foto links und unten rechts) aus der 2.
Hälfte des 12. Jahrhunderts v.
Chr., das einen realen Bezug zu den Hethitern herstellt,
|
 |
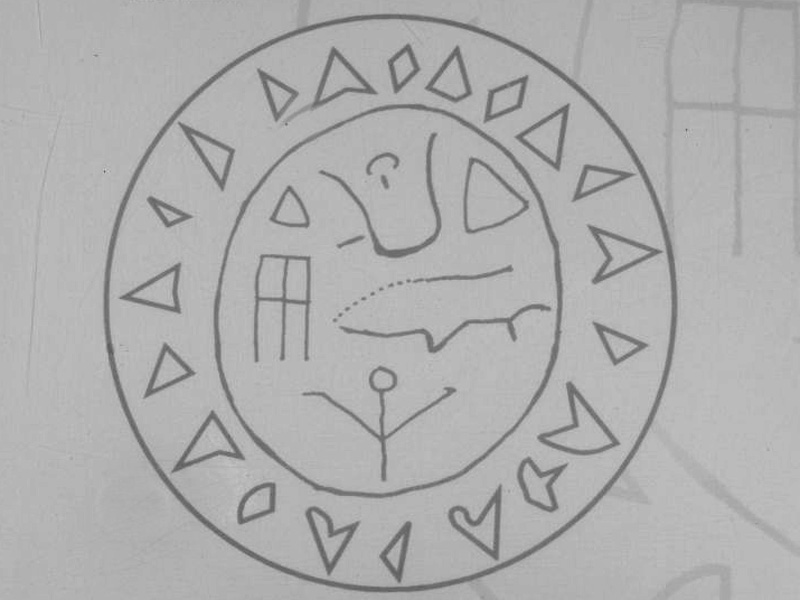 |
| ....bedient
das
40 Jahre alte Holzpferd am Eingang zur Anlage alleine die Phantasie
unzähliger Touristen aus aller Welt, die sich aus dessen Fenstern
blickend fotografieren lassen. |
timediver®'s abschließende
Bemerkung zur Besichtigung von Troja:
„Da gibt es doch außer dem
Holzpferd nichts zu sehen“ oder „das ist doch nichts“ lauteten
die Kommentare der meisten Touristen, die mit den Vorstellungen
Homers und Hollywoods die Grabungsstätte besichtigt haben.
Sicherlich gibt es keine (rekonstruierten) Monumentalbauten, wie z.B.
in Ephesos oder Pergamon, aber Troja ist ein abschreckendes Beispiel
dafür, wie schatz- und sensationslüsterne Abenteuer à
la Heinrich
Schliemann rücksichtslos zum Erreichen ihrer Visionen vorgegangen
sind. Als positiv zu bewerten ist, dass man anders als beispielsweise
beim Palast von Knossos auf Kreta nicht versucht hat, die
Bedürfnisse
der großen touristischen Scharen archäologischer Laien
mittels
Spannbetonkonstruktionen, Wandmalereien o. ä. zu befriedigen.
Insofern bleibt der Hisarlik eine archäologisch wertvolle und
beeindruckende Stätte, die allemal einen Besuch wert ist. |
 |
 |
| Die
Grabungslizenz der Universität Tübingen in dem 1996
zum Nationalpark und 1998 zum UNESCO-Weltkulturerbe
erklärten
Troja
lief zum Jahresende 2012 aus. Danach wurde mit dem in Tübingen
promovierten Prof. Dr. Ali Rüstem Aslan ein neuer Grabungsleiter
bestellt. Von dem Balkon
meines Hotelzimmers am fünf Kilometer südlich von Ayvalik
gelegenen Sarımsaklı
(Knoblauchstrand) bot sich ein Blick zur griechischen Insel Lesbos
|