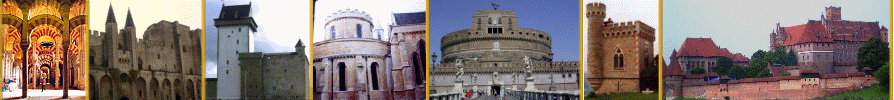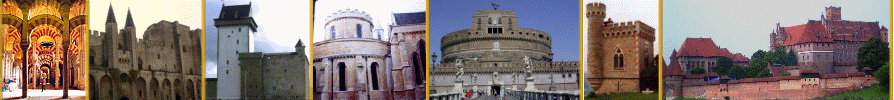|
 |
Das Iranische
Nationalmuseum ( موزه ایران باستان
/Museum des Iran der Antike)
besteht aus zwei Gebäuden mit jeweils drei Hallen, in denen
Artefakte
aus prä-islamischer und islamischer Zeit ausgestellt werden. Der
erste Bau
wurde von André Godard nach Vorbild des sassanidischen Taq-e
Kesra in
Ktesiphon entworfen und 1937 eingeweiht. In ihm findet man
Ausstellungsstücke von der frühen Altsteinzeit bis zur
Sassanidenzeit. Das Obergeschoss ist leider seit Jahren geschlossen,
so dass die Goldtafeln mit den Gründungstexten aus Persepolis und
andere Objekte aus Edelmetall nicht zu sehen sind.
|
 |
 |
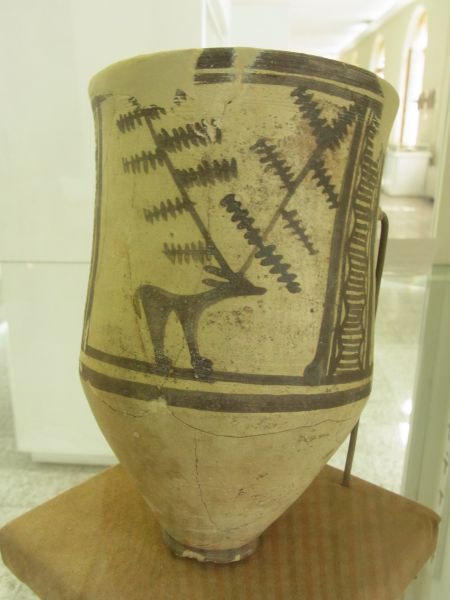 |
Im
Park vor dem Museum wurde ein Denkmal für die um 3300 v. Chr. in
Mesopotamien von den Sumerern entwickelte 'Keilschrift' aufgestellt (Foto
links). Zunächst als Bilderschrift konzipiert, umfasste die
sumerische Keilschrift rund 900 Pikto- und Ideogrammen, die in Ton
geritzt wurden. Ihre typische Keilschriftform erhielt diese Schriftart
erst jedoch erst um 2700 v. Chr., als die altsumerischen Machtzentren
Uruk, Ur und Lagash enorm anwuchsen und die zentralen
Tempelbürokratien die Rationalisierung des Schreibprozesses
erforderlich machten. Nunmehr wurden 'Keile' mit einem stumpfen
Schreibgriffel in den weichen Ton gedrückt, der anschließend
luftgetrocknet, mitunter auch gebrannt wurde. Anders als die
ägyptischen Hieroglyphen, deren Nutzung auf das Nilland
beschränkt blieb, wurde die neue 'Keilschrift' von den anderen
Kulturvölkern des Alten Orients adaptiert. In Elam löste die
'Keilschrift' um 2500 v. Chr. die dort gebrauchte proto-elamitische
Strichschrift ab. Die persische Keilschrift stellt eine Sonderform dar.
Zu Beginn der Regierungszeit von Dareios I. (521 v. Chr.) besaßen
die Perser keine eigene Schrift. Als Verwaltungssprache des
altpersischen Reiches waren Elamisch und Babylonisch in Gebrauch.
Dareios I. ordnete verfügte daher die die Entwicklung einer
'persischen Keilschrift' , die mit ihren 42 Zeichen (36 Phonogrammen, 5
Logogrammen und einem Trennungszeichen). weitaus einfacher strukturiert
und leichter erlernbar war als die babylonische und elamische
Keilschrift mit ihren ca. 600, bzw. 200 Zeichen. Obgleich die persische
Keilschrift ab 400 v. Chr. durch die Einführung des
Aramäischen allmählich verdrängt werden sollte, kann der
späteste
bekannte Keilschrifttex (astronomische Tabelle) auf das Jahr 75 n. Chr.
datiert werden.
|
Die
Keramikschale mit Fuss, Igherbōlagh - Teheran, (Foto Mitte) und die
Keramikvase vom Tepe Sialk
(Kāshān, Provinz Isfahan) stammen aus dem
dem Chalkolithikum/Kupfersteinzeit (5. Jahrtausend v.
Chr.).
|
|

|
 |
Modell
eines Hauses [?], Sang-e Chakmāq Tepe - Semnan, 5. Jahrtausend vor Chr.
(Foto links). Tonfigurinen, Sarāb - Kermānshāh, 7. Jahrtausend v. Chr.
|
 |
 |
| Keramikschüssel
mit einer Sauastika,
deren vier Haken anders als bei einer Swastika (Gammadion) nach links
gewendet sind und eine Karamikschüssel mit Fischmotiven, beide
aus
Shar-e Soukhteh - Sistān va Balochestān, 3. Jahrtausend v. Chr. (Foto
links) |
 |
 |
 |
Dreifüssige
Keramikvase (Tripode), Giyān, Provinz Hamedān, (Foto links),
Bitumenbehälter, Susā, Provinz Khuzestān (Foto Mitte) und
Figurine
(Foto rechts), alle aus dem späten 2. Jahrtausend
v. Chr.
|
|
 |
 |
Keramikschale
mit Kreuz und Getreidemotiven (Foto links), Susā, Provinz Khuzestān,
spätes 5.
Jahrtausend v. Chr. Bitumenbehälter, Susā,
Provinz Khuzestān (Foto rechts), aus dem späten 2.
Jahrtausend
v. Chr.
|
 |
 |
Die
Statue eines Bullen mit der Inschrift des elamitischen Königs
Untash-Gal aus dem späten 2. Jahrtausend wurde am Nordosteingang
der Zikkurat Dur-Untash (Chongha Zanbil), Khuzistan, ausgegraben.
|
 |
 |
| Keramikgefäße
mit Tiermotiven, Chesmeh Ali - Teheran, 5. Jahrtausend v. Chr. |
 |
 |
 |
| Drei
konische Vasen mit der 'Schlacht der Tiere' (Foto links) und
den 'Meistern der Tiere' (Fotos Mitte udn rechts), alt-elamitisch, zw.
2600-1900 v. Chr. |
|
 |
 |
Ebenfalls
alt-elamitisch sind diese typischen 'Handtaschen' aus Chlorit mit
dem 'Meister der Tiere und der Darstellung eines Tempels oder
Palastes [?].
|
 |
 |
Pfeilspitzen
und Klingen, Luristān 900 - 800 Jahrhundert v. Chr. (Foto links).
Karamikgefäß vom Tepe Sialk, Kāshān, Provinz
Isfahan), 1. Jahrtausend v. Chr.
|
 |
 |
Wagen-
und Wagenlenker aus Keramik, Amārlu - Gilān, 1 Jahrtausend v. Chr.
(Foto links) Kermik-Tierfiguren, Steinhand und Gipskopf, Susā -
Khuzistan, Achämenidenzeit, 559 - 330 v. Chr. (Foto rechts).
|
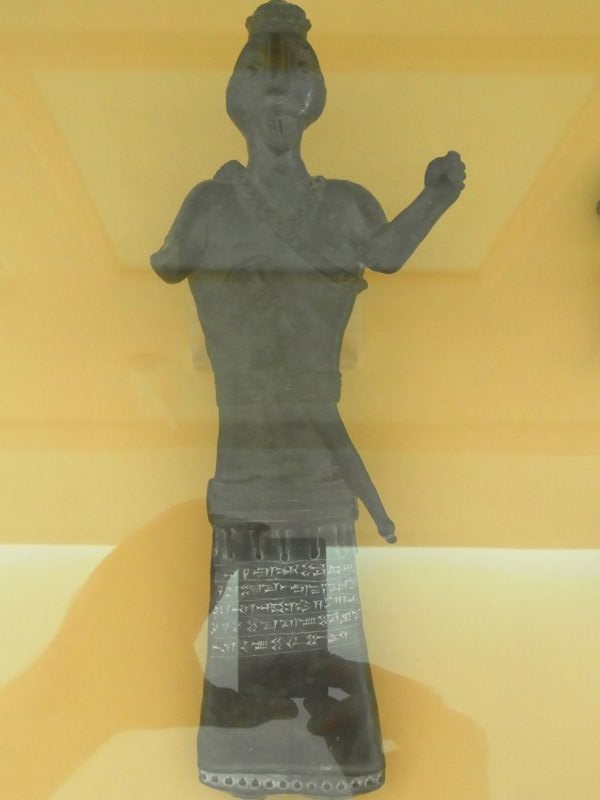 |
 |
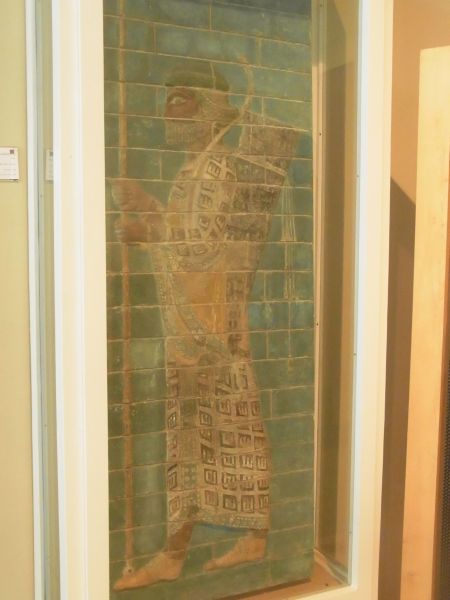 |
Bronzestatuette
eines Mannes mit babylonischer Inschrift, Luristan, 1. Jahrtausend v.
Chr. (Foto links). Kopflose Statue des Dareios I. (549 v. Ch- 486
v. Chr.) und eine Bogenschütze auf glasierten Ziegeln, Susā -
Khuzistan, Achämenidenzeit, 5. Jahrhundert v. Chr.
|
|
 |
 |
Die
'Audienz-Szene' aus dem Schatzpalast von Parsa (Persepolis)- Provinz
Fars zeigt den thronenden Dareios I. oder seinen Sohn Xerxes I. Aus der
selben Zeit und vom selben Ort stammt auch diese massive und
tonnenschwere steinerne Löwenpranke, welche einst zur Zierde einer
Säule gehörte.
|
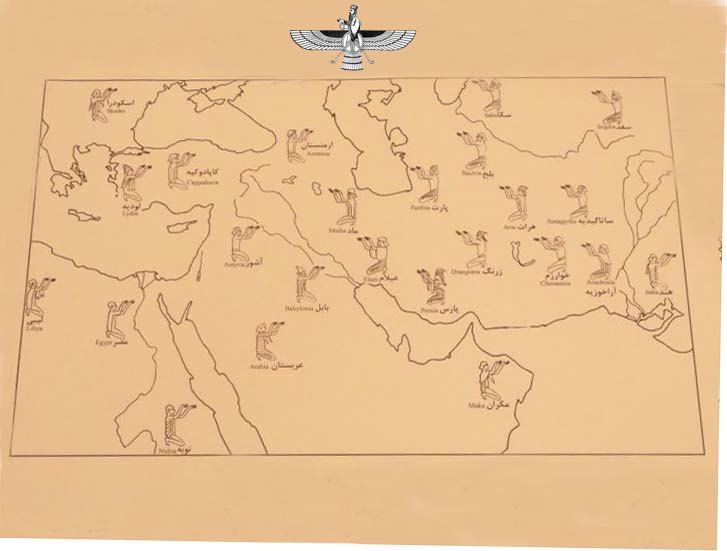 |
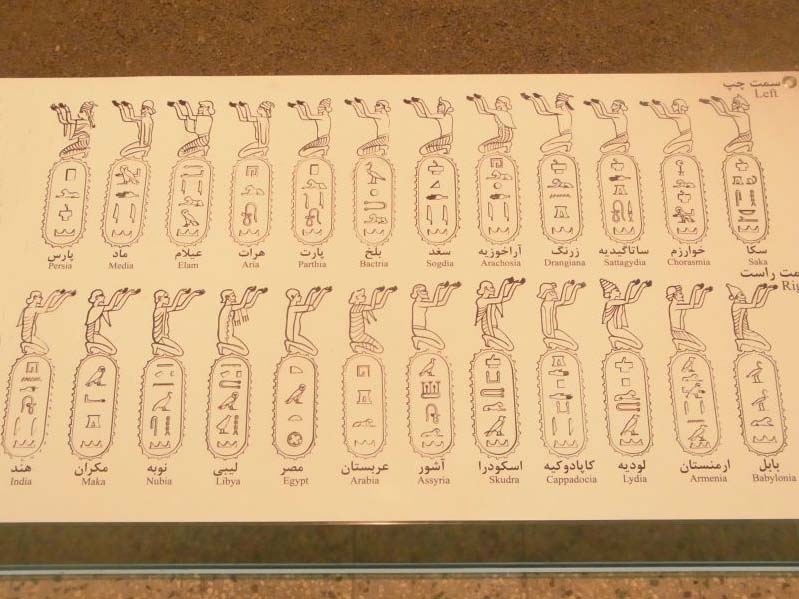 |
Die
Länder und Völker des achämenidischen Weltreiches (559 -
330 v. Chr.), welches sich als erstes über drei Kontinente (Asien,
Afrika und Europa) erstreckte. Die Verehrung des von Zarathustra
gepredigten Gottes Ahura Mazda wurde erstmals für die
Regierungszeit von Dareios I. ( 549 - 486 v. Chr.) als sicher
nachgewiesen. Der Zoroastrismus (hier in Gestalt des Faravahar)
war
jedoch höchstwahrscheinlich nicht die 'Staatsreligion' des
Achämenidenreiches. Forscher, die davon ausgehen, dass Zarathustra
zwischen 630 v. Chr. bis 553 v. Chr gelebt hatte, halten ein
Zusammentreffen zwischen ihm und Kyros II. (585–530 v. Chr.) für
wahrscheinlich. Kyros II., der sich tolerant gegenüber allen
Religionen zeigte, ermöglichte 539 v. Chr. die Rückkehr der
Juden aus ihrem Babylonischen Exil ins 'Gelobte Land'. Die
jüdische und auch spätere christliche Religion, sowie der
Islam wären ohne die Übernahme einer langen Reihe von
Synkretismen aus dem Zoroastrismus, dem ältesten Monotheismus der
Welt, in ihrer heutigen Form kaum vorstellbar. Wie
wäre wohl die Weltgeschichte weiter verlaufen, wenn die Perser in
den nach ihnen benannten Kriegen die Griechen besiegt hätten?
|
 |
 |
Ebenfalls
aus der Achämenidenzeit stammen der Bronzevogel und die Skulptur
eines Lamassu (Schutzdämon mit Stierkörper, Flügeln
& humanoiden Kopf).
|
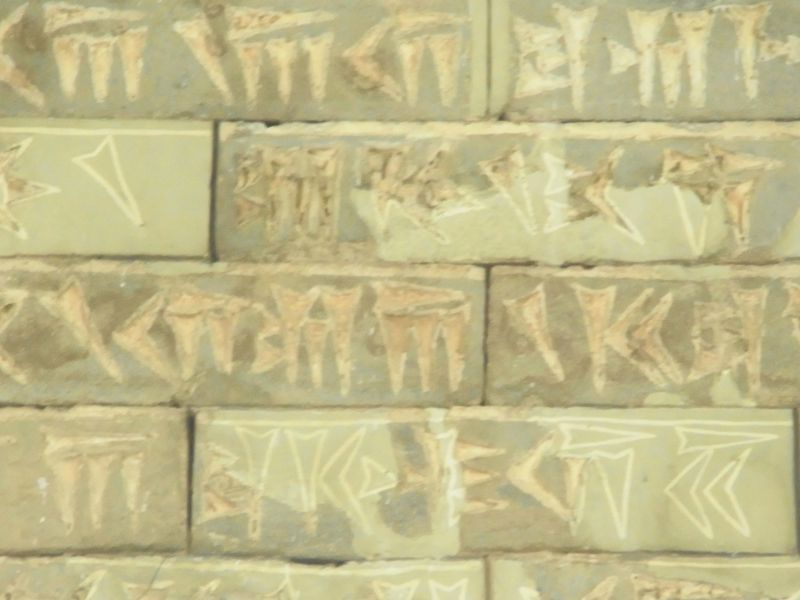 |
 |
Ziegel
mit einer Inschrift, Talar-e Bar - Persepolis, 5. Jahrhundert v. Chr.
und eine elamisch-persischen Bilingue, des Großkönigs
Xerxes I.
|
 |
 |
 |
| Lebensgroße
Bronzestatue eines parthischen Fürsten, Shami -(Izeh) Khuzistān,
250 v. Chr. - 224 n. Chr. (Foto links). Eine typische
achämenidische Säule (Foto Mitte) und die Steinskulptur eines
sitzenden Hundes, beide aus Persepolis - Provinz Fars, 5. Jahrhundert
v. Chr. |
|
 |
 |
Bronzene
Pferdefigurine und ein Relief mit persischen Würdenträgern,
Persepolis, Achämenidenzeit.
|
|
|
|
|
Relief
eines Torpfostens, Persepolis - Tachra, 5. Jahrhundert v. Chr.
Ein parthischer Krieger, Bard-e Neshandeh - Khuzistan und ein
parthisches Rhyton,
Damavand - Teheran, aus der Zeit zwischen 250 v. Chr. bis 224 n. Chr.
|

|

|
Während
der 'Salzmann' (konservierte Mumie) mittels C14-Analyse auf die
Zeit um 293 n. Chr. datiert werden konnte, stammt der glasierte,
sechsbeinige Keramik-Kerzenhalter aus dem sassanidischen Susa,
224 - 642 n. Chr.
|

|
 |
 |
 |
Viele
Exponate des Alten Orients und Altpersiens befinden sich heute in
europäischen Museen, wie dem Louvre in Paris, Britischen Museum in
London und Vorderasiatischen Museum in Berlin. Umso erfreulicher ist es
daher, dass im Teheraner Reza-Abbasi-Museum noch einige
Schmuckstücke zu sehen sind. Wie diese drei uratäische
Stab-Adoranten aus dem Nordwesten des Iran, 9. - 6. Jahrhundert.
|
|
 |
 |
Ebenfalls
uratäischen Ursprungs ist der Bronzegürtel (Foto
links). Das goldene Rhyton in Form eines Widderkopfes stammt hingegen
aus dem Medien des späten 7., bzw. frühen 6. Jahrhunderts v.
Chr.
|
 |
 |
Bronzeaxt
mit der Abbildung eines Bogenschützen/Jägers, Lurestan, 1200
- 1000 v. Chr. Der mit Stiermotiven verzierte goldene Becher
stammt ...
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
...wie
die anderen goldenen und mit Bronze legierten Artefakte aus der Zeit
der Achämeniden (559 - 330 v. Chr)-
|
|
 |
 |
|
| Ein
typisch uratäischer, konischer Helm und ein gerillter Goldbecher
mit Widderköpfen aus achämenidischer Zeit. |
|
|
 |
 |
Der
Teller aus der sassanidischen Epoche (224 - 642 n. Chr.) erinnert an
den 'byzantinischen' Doppeladler (Foto links). Auch der
Halsschmuck aus dem 5./6. nachchristlichen Jahrhudnert ist sassanidisch
(Foto rechts).
|
 |
 |
Goldenes
Rhyton in Form eines Pferdekopfes und eine Schale mit einer aus drei
Löwen geformten Triskele, beides sassanidisch, 5. - 6 Jahrhundert.
|
 |
 |
Ein
silberner Teller mit Goldinlaid und kufischer Schrift, um 1009 n. Chr.
(Foto links). Bronzene Räuchergefäße in Löwenform,
12. Jahrhundert n. Chr.
|
 |
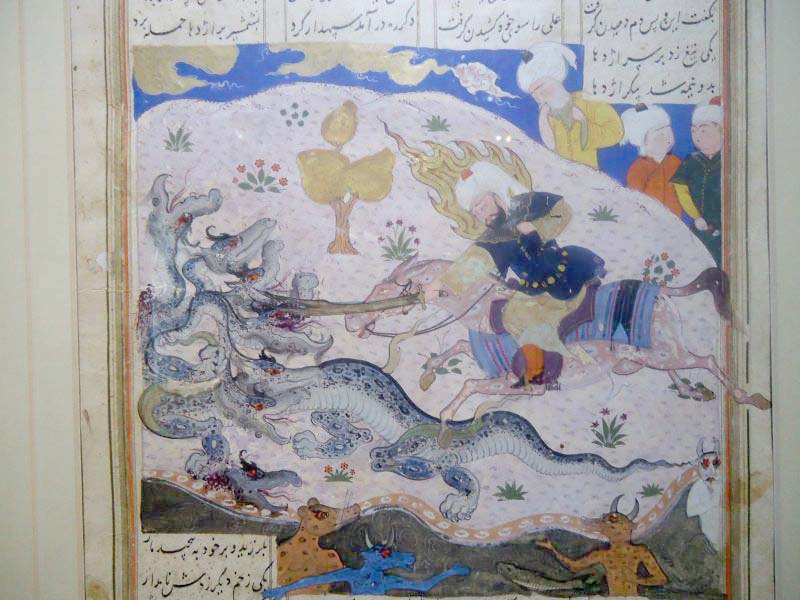 |
Dolche
mit Horngriffen, Safawidenzeit, 17. Jahrhundert. Das Blatt aus
dem 'Khawaran Nameh' (Buchara Schule, 15. Jahrhundert ach Chr.)
gehört zur umfangreichen Miniaturensammlung des
Reza-Abbas-Museums. Das allegorische Motiv zeigt den Kampf Imam
Alis gegen einen, offensichtlich das Böse verkörpernden
mehrköpfigen Drachen.
|