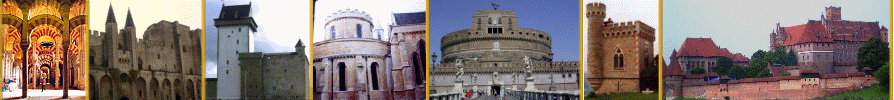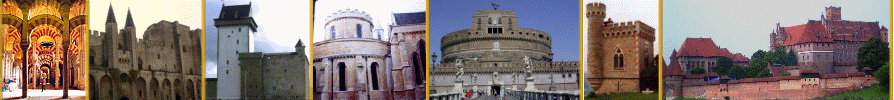Schah Mohammad Reza hatte sich
bereits durch seine Unterstützung der von den Geheimdiensten der
USA und Großbritanniens (CIA und MI6) durchgeführten
Operation TP-AJAX zum Sturz des iranischen Premierministers Mohammad
Mossadegh (1882 - 1967) in weiten Teilen des Volkes unbeliebt gemacht.
Für den im Juli 1953 von Winston Churchill und Dwight D.
Eisenhower genehmigten Plan, hatten die Regierungen
Großbritanniens und der USA ein Budget von $ 285.000
bereitgestellt. Wichtigster Grund für diese historische und in
ihrer Art für weitere Aktionen beispielgebende
angelsächsische Einmischung in die Angelegenheiten eines
souveränen Staates, war die Verstaatlichung der
Ölförder- und Raffinerieanlagen (Abadan-Krise).
Den Anlass dafür bot die von Großbritannien geführte
und das Ölgeschäft des Irans dominierende internationale Anglo-Iranian Oil Company
(heute BP), die sich
hartnäckig geweigert hatte, das im Jahre 1993 über eine
Laufzeit von 60 Jahren abgeschlossene Abkommen zu revidieren und ihre
Gewinne aus dem Ölgeschäft gerecht mit dem Iran zu
teilen. Während der Staatsanteil in den benachbarten
Erdölförderländern aufgrund von Verträgen mit
amerikanischen Mineralölkonzernen bei bis zu 50 % lag, wollten die
Engländer weiterhin die Iraner mit nur 20 % Gewinnbeteilung
abspeisen. In einem erbitterten diplomatischen Kampf hatten die Briten
vergeblich versucht, eine Rücknahme der Verstaatlichung zu
erwirken. Die USA schwenkten schließlich auf die britische Linie
ein, weil sie von Churchill 'überzeugt' worden waren, dass
Mossadegh durch ein Bündnis mit der kommunistischen Tudeh Partei
dem Kommunismus in Iran Tür und Tor öffnen würde.
|
Im
Gegensatz zu seinem Vater Reza Schah, der im schiitischen Klerus eines
der Haupthindernisse auf dem Weg des Irans in die Moderne sah und daher
drastische Maßnahmen zu Minimierung von dessen Einflusses
ergriffen hatte, strebte Mohammad Reza einen Ausgleich an. Ajatollah
Gomi, der wenige Jahre zuvor aus Protest gegen die antiklerikale
Politik Reza Schahs den Iran verlassen hatte, nahm die Einladung
Mohammad Reza Schahs an und kehrte im Juni 1942 unter dem Jubel von
mehr als 100.000 Teheranern zurück. Mohammed Reza hatte ihm
zugesichert, die feindselige Politik seines Vaters gegenüber der
Geistlichkeit nicht fortzusetzen, das Tragen des Tschadors wieder zu
erlauben, den Religionsunterricht in den Schulen inklusive eines
Schulgebets einzuführen und auch die Koedukation umgehend
abzuschaffen. Mohammad Reza Schah entsprach den Forderungen Gomis. Im
neuen politischen System unter Mohammad Reza gewann der schiitische
Klerus wieder an Macht und Einfluss. Der junge Schah war dem
Trugschluss erlegen, dass alle Mullahs 'aus ihrem tiefstem Herzen
heraus Monarchisten' seien und ihnen bewusst sei, dass der Islam
im Iran aufgrund einer latenten kommunistischen Bedrohung nur mit der
Monarchie überleben könne. Mit seiner 'Weißen Revolution'
(1963) und der Gründung des Geheimdienstes SAVAK, der neben
marxistischen auch und islamische Bewegungen bekämpfte, zog sich
Schah Mohammed Reza den Zorn des
Ruhollah Musavi Chomeini/Khomeini (1902 - 1989) zu, der ihn in
seiner
'Rede gegen den Tyrannen unserer Zeit' bereits am 3. Juni 1963 während
der Aschura-Feierlichkeiten in der Faizieh-Schule von Qom als
zionistischen Agenten persönlich angriff. Mit der
anschließenden Verhaftung Chomeinis und dessen Exil in Bagdad
sollte schließlich eine Entwicklung einsetzten, die weder durch
die Repressionen des SAVAK (Sazeman-e
Ettela’at va Amniat-e Keshvar), noch durch den 1977 propagierten
'Offenen politische Raum', der eine Abschaffung der Zensur, die
Einführung der Versammlungsfreiheit, die
Zulassung demokratischer Parteien und die Abhaltung freier Wahlen
vorsah, abgewendet werden konnte. Die unglaublichen Kosten für die
vom 12. bis zum 16. Oktober 1971 ausgerichtete 2500-Jahr-Feier der Iranischen Monarchie,
mit der Mohammad Reza an den Ruhm und die Größe der antiken
Achämeniden anzuknüpfen versuchte, waren ein weiterer
Mosaikstein, der den Verdruss und die Zahl seiner Gegner wachsen
ließ.
|
 |
 |
Im Zuge
der Konferenz von Guadeloupe, die sich auf Einladung des
französischen Präsidenten Valéry Giscard d’Estaing vom
4. Januar bis 7. Januar 1979 auf der französischen Karibikinsel
als informelles Treffen nach dem G7-Gipfel zusammen gefunden hatte,
entzog der Westen, allen voran US-Präsident Jimmy Carter, Schah
Mohammad Reza Pahlavi seine weitere Unterstützung. Valéry
Giscard d’Estaing wurde beauftragt, den Kontakt zu Ajatollah Chomeini,
der in Paris eine Allianz aus Mullahs, Bürgerlichen und Linken zum
Sturz des Schahs schmiedete, herzustellen und die Frage eines
möglichen Regierungswechsels zu erörtern. Mit den Worten 'Ich
bin müde und brauche eine Pause' verließ Schah Mohammad Reza
Pahlavi am Mittag des 16. Januar 1979 über den Teheraner Flughafen
den Iran, dieses Mal für immer.
|
Im
Teheraner Stadtbild ruft das Plakat eines jungen Iraners den 'Sturz des
Schahs' in Erinnerung (Foto links), während
großformatige Leinwände die Islamische Revolution und ihrer
Protagonisten preisen (Foto rechts).
|
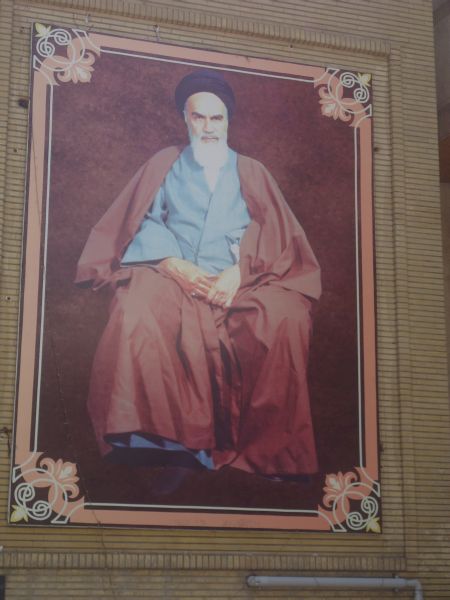 |
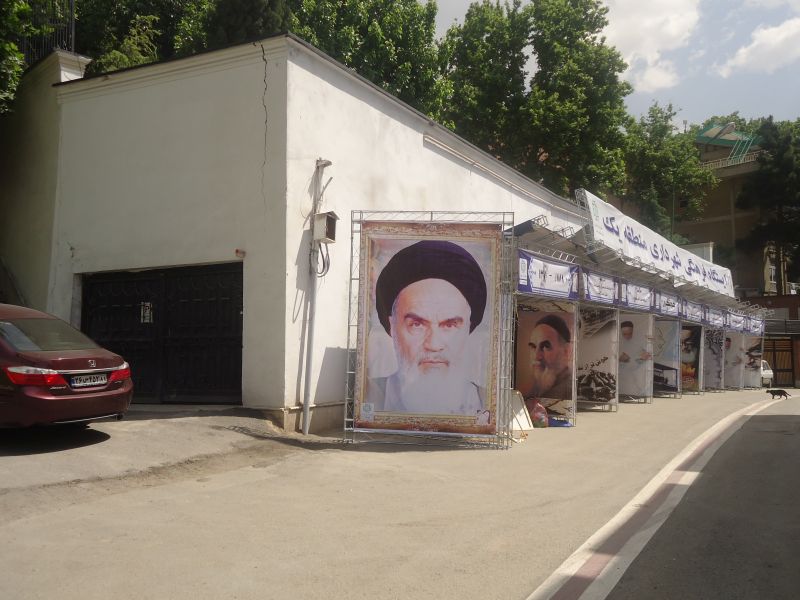 |
Das
einstige Teheraner Wohnhaus des Imam Ayatollah Sayyid Ruhollah Musavi
Chomeini (Khomeini) befindet sich in Jameran, einem zu den höher
gelegenen
'shemiranat' (kühleren Orte) gehörenden Stadtteil am
Fuße des Alborz. Die nach dort führende Straße Hasani Kia, wird von zahllosen
Porträts des Revolutionsführers gesäumt.
|
 |
 |
| Die
bereits 1865 Versammlungshalle
Husayiah Jamaran (Foto links) war bereits im Jahre 1903 von Sayyid Ibrahim Jamarani treuhänderisch
der Gemeinde von Jamaran übergeben worden. Im Jahre 1980 wurde das
an seiner Nordseite befindliche Wohnhaus (Foto rechts) von Sayyid Mahdi Imam Jamarani Ayatollah
Chomeini und seiner Familie, die selbst keine Immobilie in Teheran
besaßen, zur untentgeltlichen Nutzung überlassen. Dennoch
zahlte Hadrat Imam eine
monatliche Miete von 80.000 Rials. |
Während
die Nachkommen des älteren Enkels des Propheten Mohammed und
Sohnes Alis, Hasan, den Ehrentitel Sherif
(arab. Edler) tragen, werden die Nachkommen Husains als Sayyid (arab. Herr) bezeichnet.
Letztgenannte sind fast ausschließlich im Irak und im Iran
beheimatete Schiiten, etwa 600.000 an der Zahl. Ihr
Hauptsiedlungsgebiet im Iran ist seit dem 7. Jahrhundert die
Umgebung der Stadt Qom. Zu
erkennen sind die Sayyids an ihren
schwarzen Turbanen. Eine
Nachkommin Husains wird Sayyida
genannt, von denen die bekanntesten
seine
Tochter Sayyida Sukaina und deren Tochter Nafisa at-Tahira sind. Die
letztgenannte war eine Lehrerin von asch-Schafi'is, dem Begründer
der
schafiitischen Madhhab (Rechtsschule) im sunnitischen Islam. Nachkommen
einer Sayyida in weiblicher Linie werden auch Mirza genannt,
von denen es etwa 1 Million im Iran gibt.
|
 |
 |
| Die
Veranda von Chomeinis Wohnhaus von der ein Steg zur Versammlungshalle Husayiah Jamaran führt (Foto
links). In einem Raum unmittelbar hinter der Veranda (Foto rechts)
empfing Imam Chomeini neben iranischen auch ausländische Politiker
und Würdenträger. |
Die
iranischen Zwölferschiiten gehen davon aus, dass es angefangen bei
Alī ibn Abī Tālib zwölf Imame
gab, wobei der letzte als Mahdi,
der verborgene Imam ist. Zusammen mit dem Propheten Mohammed und dessen
Tochter Fatima gelten die zwölf Imame als die 'Vierzehn Unfehlbaren'.
Nach schiitischer Vorstellung erbt der Imam das geheime Wissen und
Verständnis des Korans und besitzt eine exklusive Autorität
in der Interpretation seines Inhalts und der Aufstellung des
islamischen Rechtssystemes. Seit dem 9. Jahrhundert wird ein Imam als
der perfekte und unfehlbare Interpret und Richtungsweisende zur wahren
Religion (ma’sum) angesehen. Der verborgene zwölfte Imam wird als
Mahdi ('Messias'), der die Welt nach seiner Rückkehr zum wahren
Glauben führen wird, verehrt. Daneben wird die Bezeichnung Imam
aber auch als Ehrentitel für besonders fromme oder gelehrte
Persönlichkeiten im sunnitischen Islam verwendet, wie für die
Begründer der vier Richtungen der Normenlehre, der Theologe und
Rechtsgelehrte Imām al-Haramain („Imam der beiden heiligen
Stätten“) und auch Hasan al-Bannā, der Gründer der
ägyptischen Muslimbruderschaft, der von seinen Anhängern
al-Imām aš-šahīd (Märtyrer-Imam) genannt wird. In der Zwölfer-Schia wird seit den
1980er Jahren auch Ayatollah Chomeini mit dem Titel Imam geehrt.
|
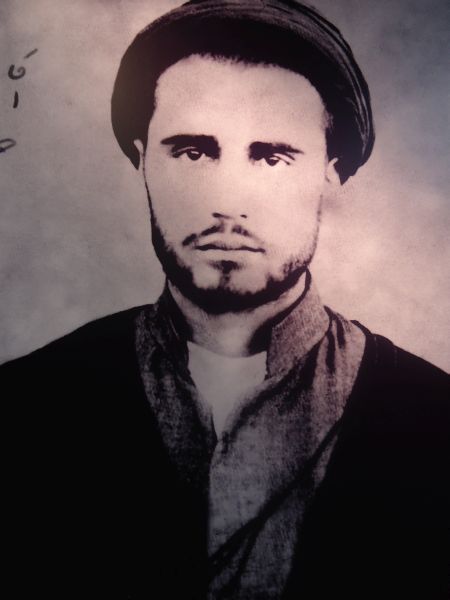 |
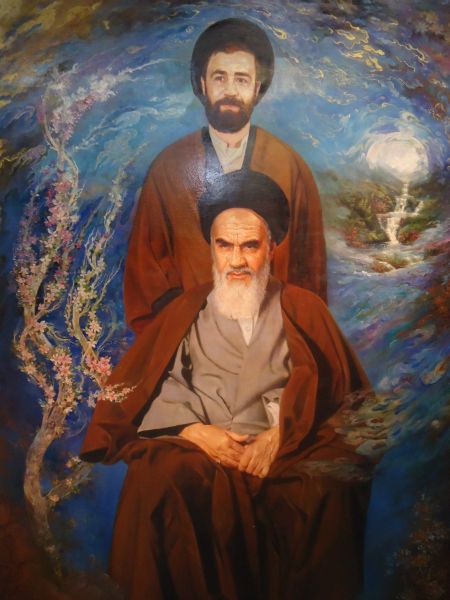 |
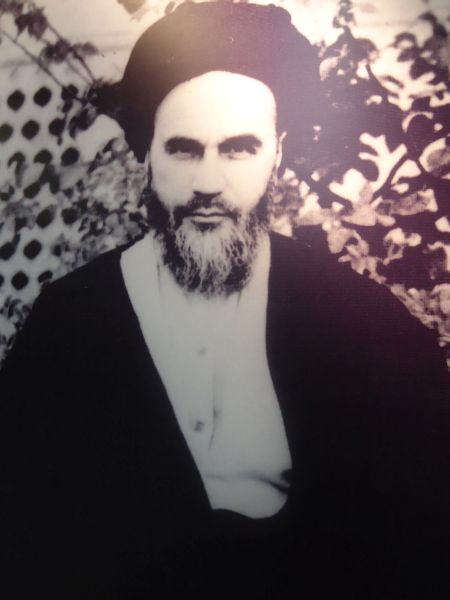 |
Im
Jahre 1999 wurde vom damaligen iranischen Präsidenten Mohammad
Chātami (*1943) die Jamaran Galerie
eingeweiht, in der anhand von Bildern Fotos und Dokumenten das Leben
und die Arbeit Chomeinis nachgezeichnet werden. Während die beiden
Fotos Chomeini im jüngeren und fortgeschrittenen Alter zeigen, ist
er auf dem Bild in der Mitte mit seinem zweitältesten Sohn Ahmad
(1946 -1995) zu sehen, der unter ebenso geheimnisvollen Umständen
verstarb, wie zuvor sein älterer Bruder Mustafa (1932 - 1977).
|
|
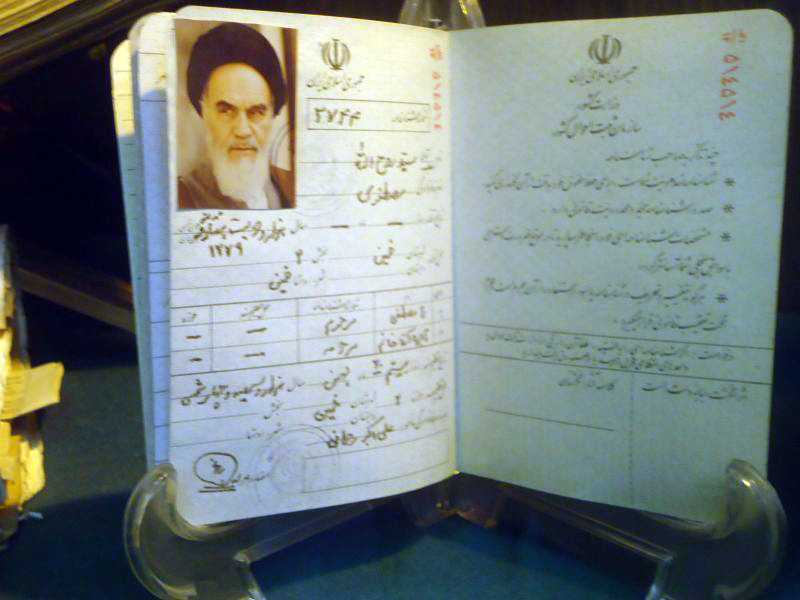 |
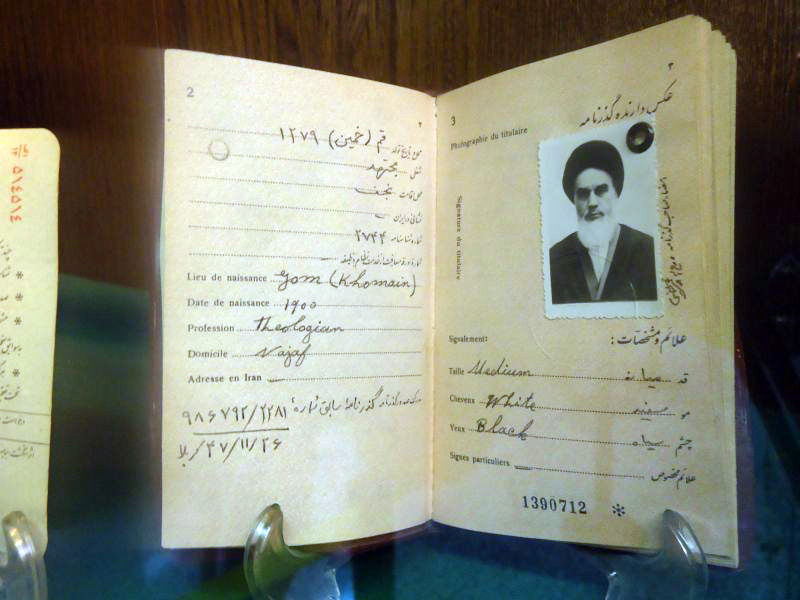 |
Auch
diese beiden Ausweispapiere Chomeinis gehören zu den
Ausstellungsstücken.
|
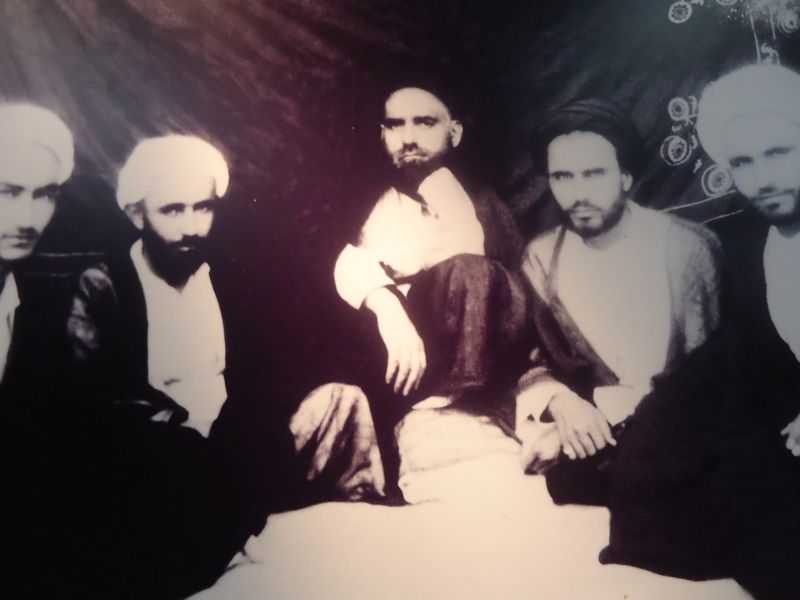 |
 |
Der junge
Chomeini (zweiter von rechts) im Kreise seiner Kommilitonen an der
Rechtsschule des Abdolkarim Haeri Yazdi in Qom, wo er 1936 neben der
Qualifikation eines Mudschtahid den religiösen Titel eines
Hodschatoleslam erwerben konnte und 1943 seine erste Schrift Kašf al-asrār (Enthüllung der
Geheimnisse), in der er auch die Abschaffung der Monarchie propagiert,
veröffentlichte. Nach einem Flug mit einer
Air France Boeing 747 von Paris aus betrat Chomeini am 1. Februar 1979,
um 9.39 Uhr Ortszeit auf dem Mehrabad International Airport zum
ersten Mal seit über 14 Jahren wieder iranischen Boden. Zu
der privilegierten Entourage,
die Chomeini bei seiner Rückkehr in den Iran im Flugzeug begleiten
und danach in den Monaten der Revolution mehrfach interviewen durften
gehörte auch der deutsch- französische Journalist und
Publizist Peter Roman Scholl-Latour (*1924 in Bochum).
|
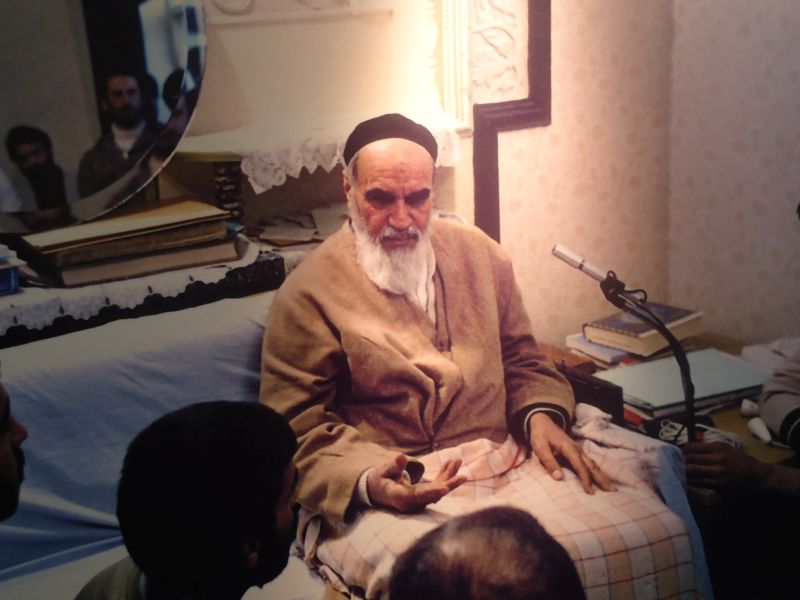 |
 |
| Chomeini
bei einer 'Audienz' auf der Couch seines Verandazimmers (Foto links)
und im Kreise seiner Familie während eines Behandlungsaufenthaltes
im Martyr Raja'i Cardiac Hospital von Teheran (Foto rechts).
|
 |
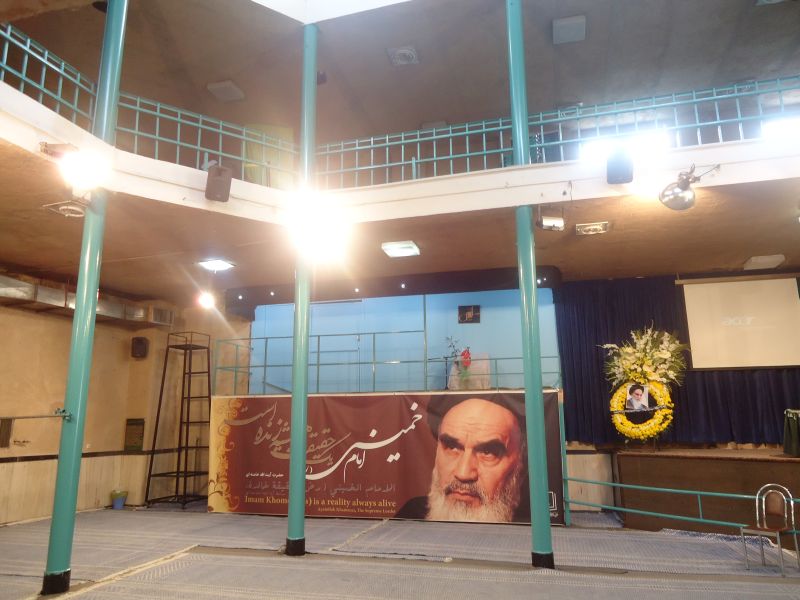 |
Chomeini
spricht von einer Tribüne in der Husayiah
Jamaran zu seinen ausländischen Gästen (Foto links).
Die Tribüne, hinter der sich der Steg zu Chomeinis Wohnhaus
befindet, gibt es heute noch, die Wände der Versammlungshalle sind
allerdings mittlerweile verputzt (Foto rechts).
|
 |
 |
In der
Mitte des überdachten Weges zur Hasani Kia fließ ein Frischwasserkanal, der an die
berühmten 'Freiburger Bächle'
erinnern lässt. Unserer Reisegruppe wurde hier nicht nur ein
ein Imbiß in Form eines Kuchens und gekühlten
Fruchtsaftes kredenzt, sondern - ebenfalls gratis - eine Reihe von DVDs
und CDs, unter anderem mit iranischer Musik überlassen. Das 10
Kilometer südlich von Teheran, in der Nähe des Friedhofes
Behesht-e Zahra (Paradies von Zahra) errichtete Chomeini-Mausoleum beherbergt neben
dem Schrein des Ayatollahs auch die Schreine seiner 2009 verstorbenen
Ehefrau Khadijeh Saqafi und seines Sohnes Ahmad. Nach wie vor im Bau,
soll es nach seiner Fertigstellung das Kernstück eines sich
über 20 qkm erstreckenden Komplexes sein, der neben einer Akademie
für Islamstudien, ein kulturelles und touristisches Zentrum mit
einer Einkaufspassage und einem Parkplatz- gelände für bis zu
20.000 Fahrzeuge beherbergen soll. Der Ort ist Pilgerstätte
für Anhänger Chomeinis, von denen zu seiner Beisetzung etwa
10 Millionen Menschen erschienen waren. Für iranische
Regierungspersonen besitzt das Mausoleum eine große symbolische
Bedeutung, der auch beim Besuch ausländischer
Würdenträgern Rechnung getragen wird. Mit der Pflege des 2
Milliarden teuren Projektes wurde Chomeinis Enkel Hassan betraut.
|
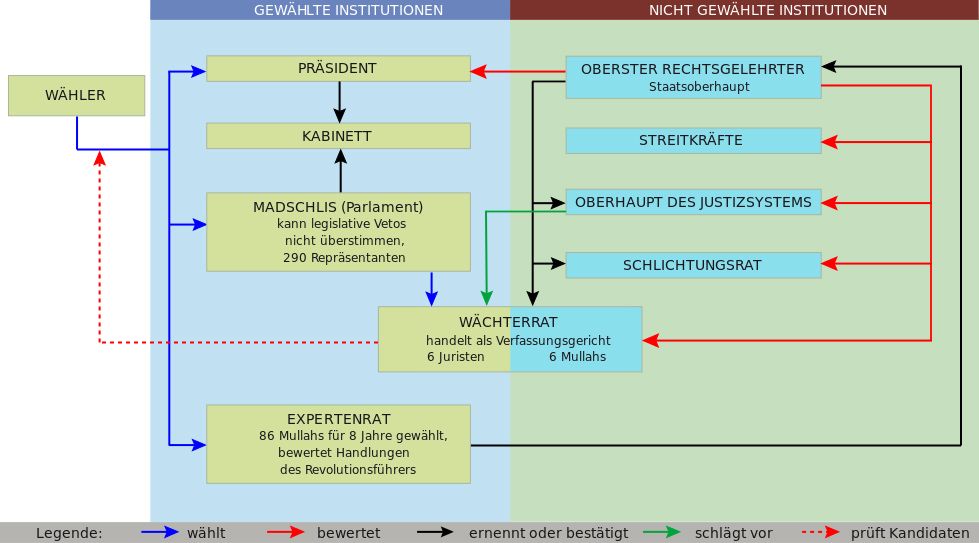 |
Zu
Chomeinis Vermächtnis gehört die Verfassung der am 1. April
1979.
proklamierten Islamischen Republik Iran, die neben theokratischen auch
demokratische Elemente vorweist.
(Grafik, Quelle Wikipedia)
|
Eine
komplette und differenzierte Darstellung von Chomeinis 'Taten
und Positionen', wie die Geiselnahme in der US- Botschaft, die
Verfolgung, Liquidierung und Massenhinrichtungen politischer
Gegner,
sowie die Fatwa gegen Salman Rushdie usw. würden den Rahmen dieser
homepage sprengen.
|
|
|
|