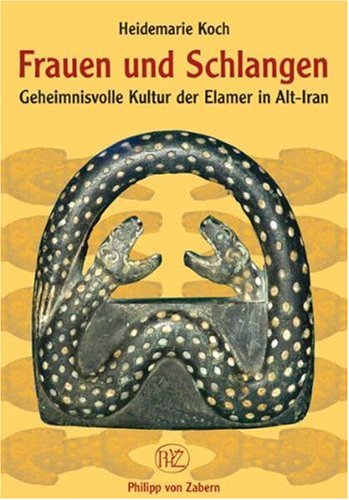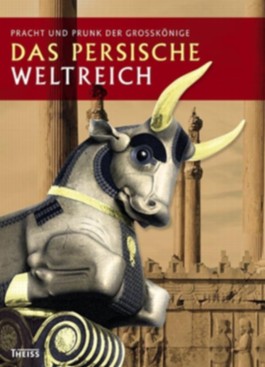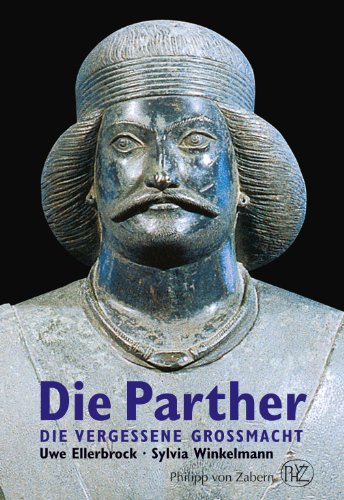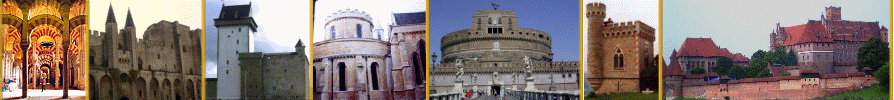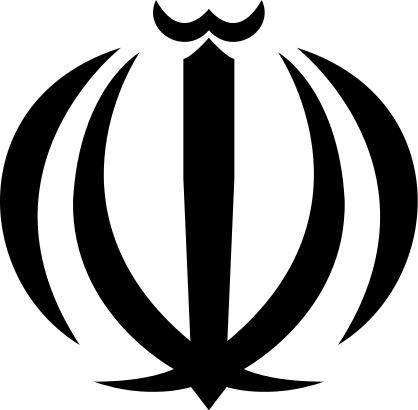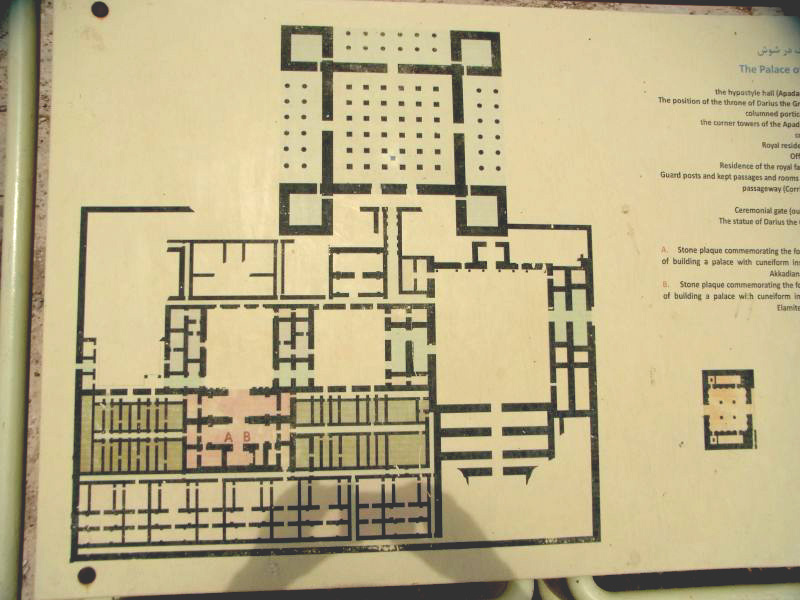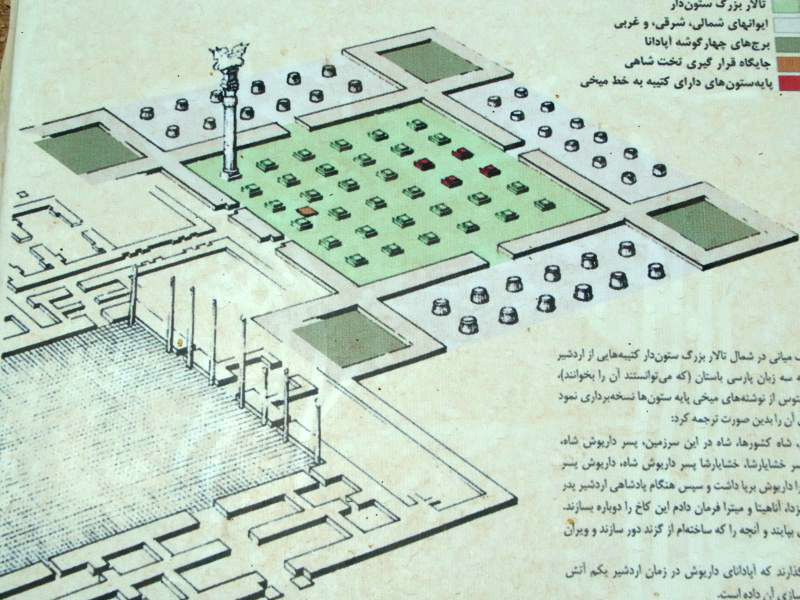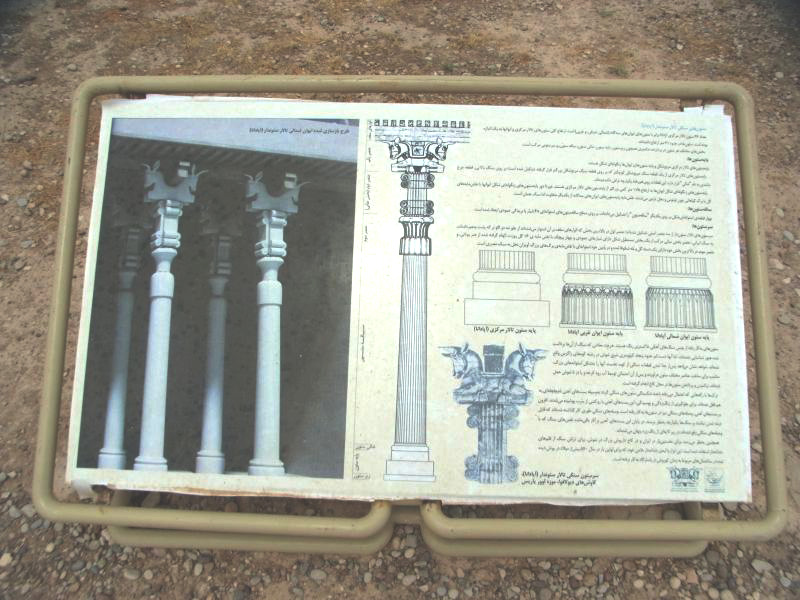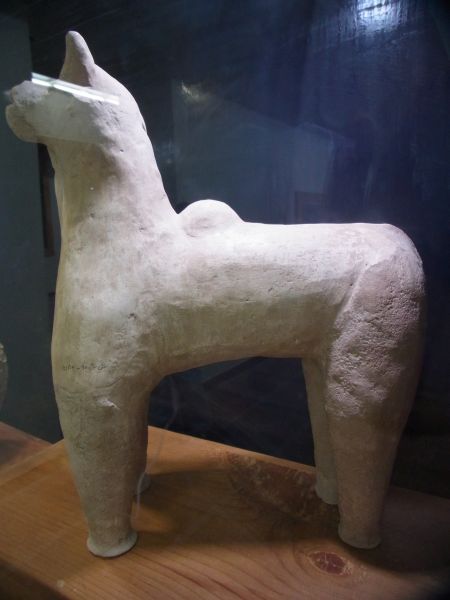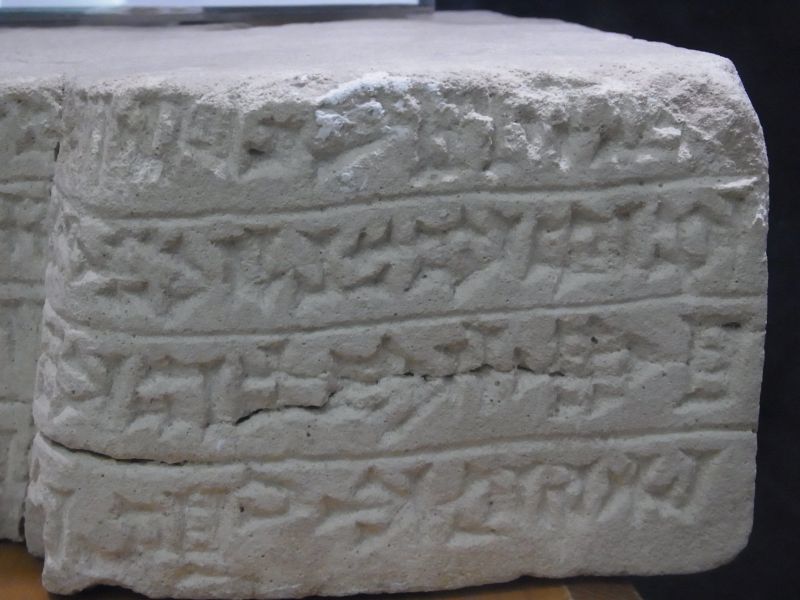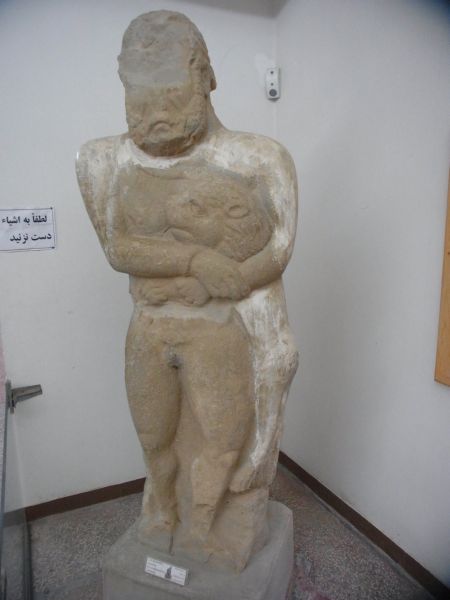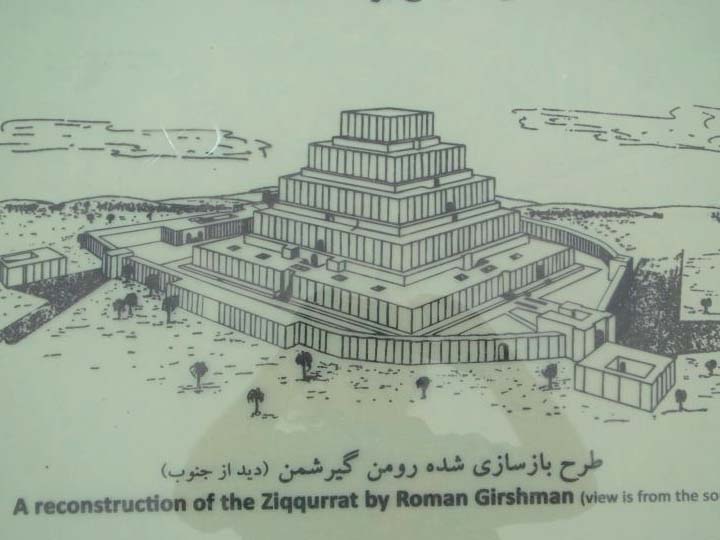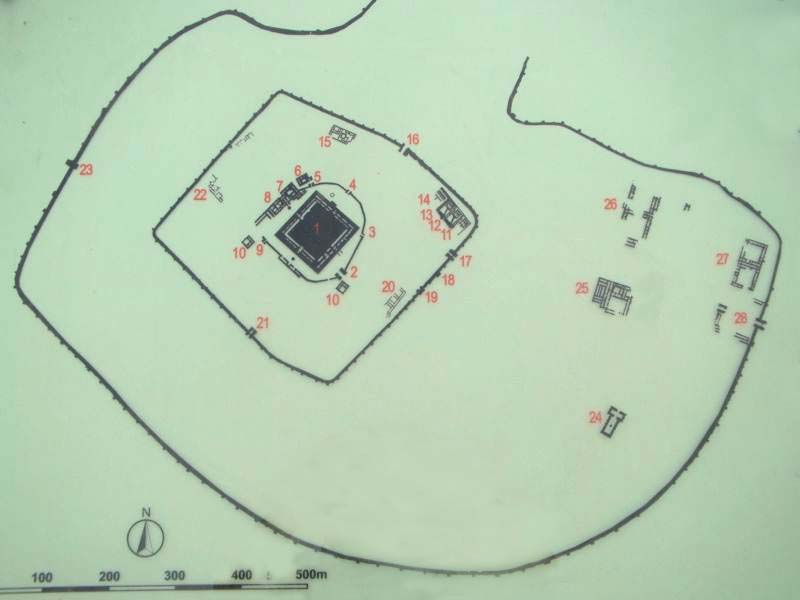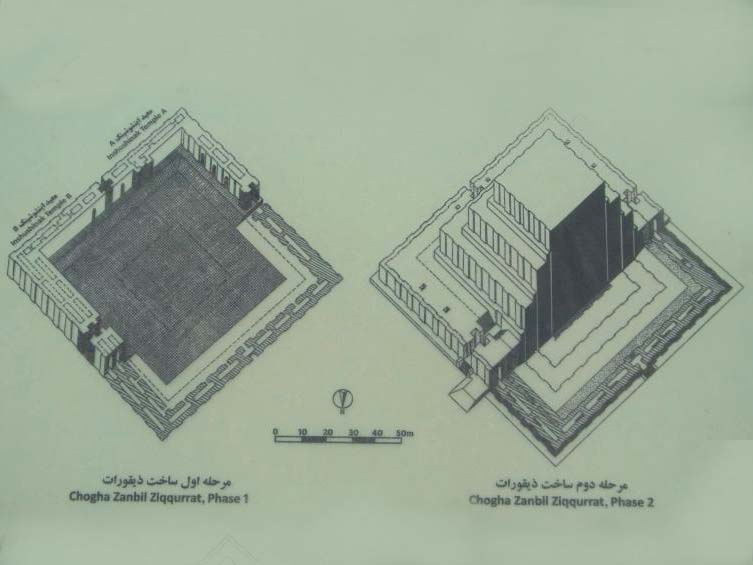|
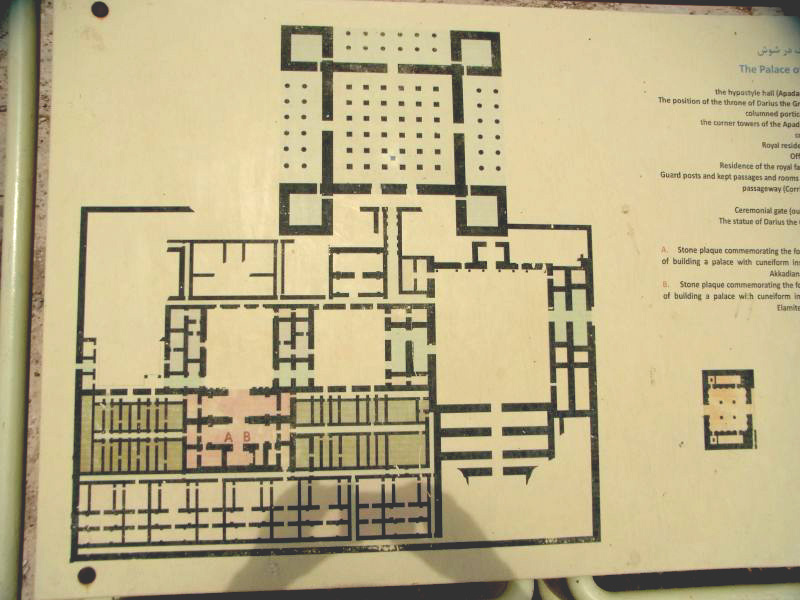 |
Im
Zentrum des Ortes Shush
(Provinz Khuzistan), direkt am Shaur-Fluss, wurde im 12. Jahrhundert
ein Heiligtum errichtet. Die häufig umgebaute und immer wieder
erneuerte Pilgerstätte mit ihrem konischen Turm wird als Mausoleum
des Propheten Daniel angesehen. Gleichwohl die Bibel nichts über
den Tod Daniels berichtet, könnte er sich während des
Babylonischen Exils in einstigen Susa aufgehalten haben, so daß
nach jüdischer und islamischer Überlieferung sein Grab hier
zu finden ist. Erstmals schriftlich erwähnt wurde das Grab von
Benjamin von Tudela, der den Ort im Jahre 1160 besucht hatte. Das
vorgeschichtliche und antike Susa (hebräisch Schuschan) war von
etwa 4000 v. Chr. bis zu seiner Zerstörung durch die Mongolen
1259 n. Chr. mehr oder weniger kontinuierlich besiedelt. Nur etwa 500
Meter oberhalb des Danielgrabes befindet sich der Apadama-Hügel mit den
freigelegten und konservierten Resten des einstigen Palastes des
Großkönigs Dareios I. ( 549 v. Chr - 486 v. Chr.). Im
Gegensatz zu den aus Persepolis bekannten achämenidischen
Palastanlagen, deren Wände mit steinernen Reliefplatten verkleidet
waren, zeichnete sich der Palast von
Susa durch einen Bauschmuck aus, welcher aus der elamischen
Tradition erwachsen war. Alle Fassaden waren mit farbig glasierten
Ziegelbildern geschmückt und die Räumlichkeiten mit
verschiedenen kostbarsten Materialien der damaligen Welt ausgestattet.
Der Palast besaß drei Innenhöfe und eine Grundfläche
von 246 x 155 Metern.
|
 |
 |
Die
Fundamente des Palastes mit den privaten Wohngemächern Dareios I.
von Süden (Foto links), Westen (Foto rechts) ....
|
|
 |
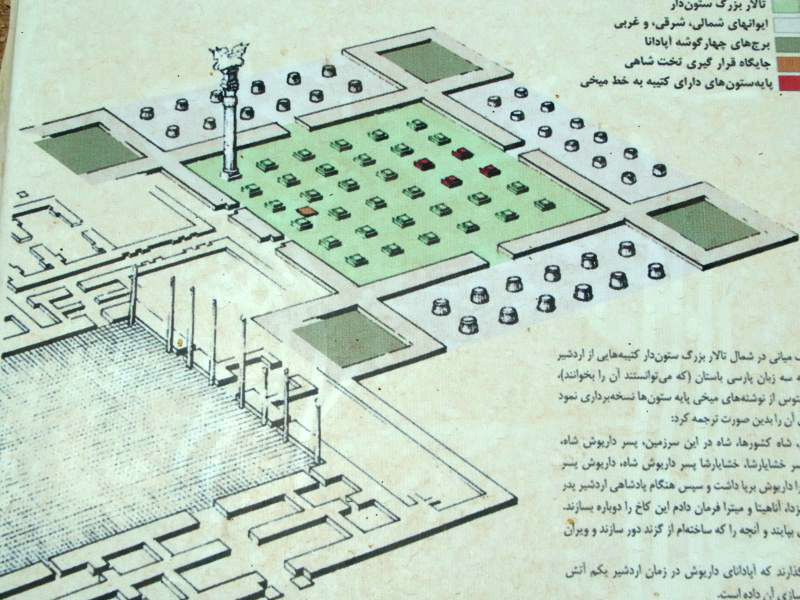 |
....und
Osten (Foto links) aus gesehen. Nördlich des Zentralhofes befand
sich der offizielle Teil des Palastes, das 109 x 109 Meter messende Apadana (altpers.: Palast). Sein
Inneres beherbergte eine von 6 x 6 Säulen getragen Halle, deren
vier Seitenlängen jeweils 58 Meter betrugen.
|
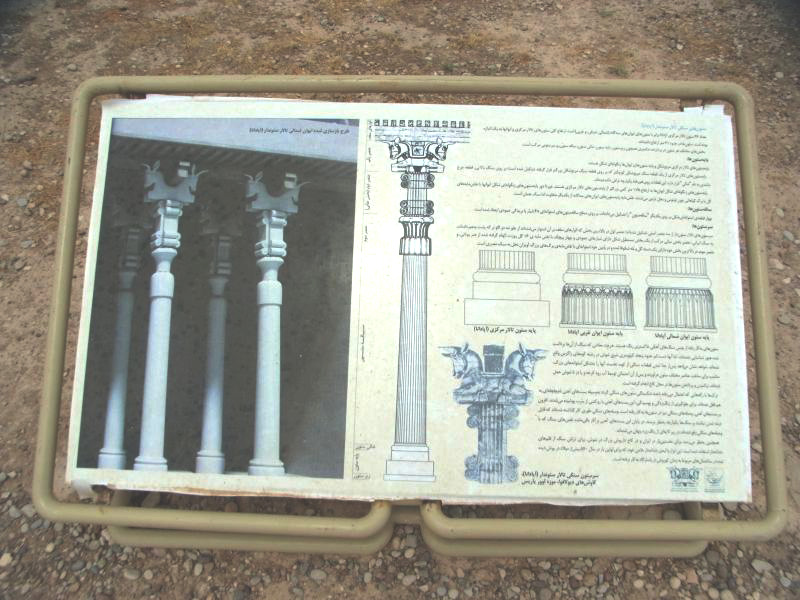 |
 |
| Alle 36
Säulen besaßen eine Glockenbasis, einen kannellierten Schaft
und ein Doppelstierprotomen-Kapitell. |
 |
 |
Die
kümmerlichen Reste der Säulen....
|
 |
 |
...und
einer Löwenskulptur lassen die einstige Pracht bestenfalls
erahnen. Einen besonderen Anachronismus stellt das Château de Suse dar, das
in den späten 1890er Jahren von Jean-Marie Jacques de Morgan als
sichere Basis für die Plünderung der Ausgrabungsstätte
auf einem benachbarten Hügel errichtet wurde. Angelehnt an die
Bauten des europäischen Mittelalters, von örtlichen
Handwerkern aus Ziegeln erbaut, gilt die Festung als
verspätete und gleichzeitig östlichste
Kreuzritterburg. Da der 'Donjon' ohne Rücksicht auf
ältere archäologische Schichten und Relikte vergangener
Zeiten auf dem 'Tepe' errichtet wurde, ist er auch ein
Beispiel für die vorwissenschaftliche Ära der
Archäologie, in der es lediglich darum ging, dem Boden
möglichst viele Schätze und Antiquitäten zu
entreißen. Der ehemalige Französisch Staatseigentum wurde
von der Islamischen Republik nach der iranischen Revolution im Jahr
1979 übernommen. Es wird heute als Museum genutzt. Zu den
bekanntesten Halte ist eine Keilschrifttafel mit dem Codex Hammurabi
eingeschrieben, dies ist jedoch heute im Louvre in Paris, Frankreich.
Nachdem die Burg während des Irak-Iran-Krieges (1980 - 1988) durch
irakische Bomben stark beschädigt worden war, wurde sie nach
Kriegsende komplett wiederhergestellt.
|

|
Auch die
als 'Codex Hammurapi'
bezeichnete, 2,25 Meter hohe Dioritstele wurde hier zum Jahreswechsel 1901/1902
vom dem schweizer Ägyptologen Gustave Jéquier (1868 -1946)
in
drei Bruchstücken gefunden. Bereits im April 1902 wurden diese,
wieder zu einer Stele zusammengesetzt durch das von
Jacques de Morgan (1857 - 1924) geleitete 'Expeditionsteam' außer
Landes geschafft und in den Bestand des Pariser Louvre aufgenommen. Die
ursprünglich um 1750 v. Chr., wahrscheinlich in Sippar, der Stadt
der Sonnengottes Schamasch in Mesopotamien errichtete Stele, war als
Kriegsbeute des elamischen Königs Shutruk-Nakhunte II. (Reg. um 1185–1155 v. Chr.) in
dessen Hauptstadt Susa gebracht worden.
|

|

|
| Die
Elamer (Elamiter im AT, Esra 4,9) waren wie ihre westlichen
Nachbarn die Sumerer weder
ein indoeuropäisches oder semitisches Volk noch miteinander
verwandt. Die Bezeichnung Elam entstammt dem griechischen Bezeichnung
Aylam, das wiederum aus dem hebräischen Wort Elam entlehnt worden
war. Die Eigenbezeichnung lautete
'Haltampt' (Land des Herrn/Gottes-/ Königsland). An der
Stelle des späteren Susa wurde
bereits um 4000 v. Chr eine erste Siedlung gegründet.
Zwischen 3450 v. Chr. und 3100 v. Chr., parallel zum Aufstieg des
sumerischen Stadtstaates Uruk (späte Uruk-Periode) entwickelte
sich Susa zum politischen und religiösen Zentrum von Elam. Aus
dieser Epoche stammen die ältesten Schriftdokumente in
proto-elamischen Strichschrift. Die Entwicklung der Schriftsysteme von
Sumer und Elam entwickelten sich vollkommen unabhängig
voneinander. Ethnisch und entfernt auch sprachlich werden
die Elamer mit den
dravidischen Völkern in Verbindung gebracht, von denen man
annimmt,
dass sie aus dem iranischen Hochland nach Indien eingewanderten.
Demnach haben sich die Vorfahren der Elamer bereits vor der
Ostwanderung ihrer dravidischen Verwandten in Mesopotamien
niedergelassen. |
Die
dravidischen Völker der Kannadigas, Malayalis,
Telugus und Tamilien sind heute in Südindien, das letztgenannte
auch
auch in Sri Lanka beheimatet. Daneben gibt es mit Brahui jedoch auch
eine norddravidische
[!] Sprache, die sich 2000
Kilometer von ihren südindischen Pendants entfernt in
Sprachinseln bei
2,2
Millionen Sprechern in Pakistan, Afghanistan und der iranischen Provinz
Sistan und Belutschistan behaupten
konnte. Die tamilischen Separatisten auf der Insel Sri
Lanka bezeichnen den von ihnen geforderten eigenen Staat als Tamil
Eelam (Tamililam). In
der heutigen Islamischen Republik Iran hat sich der Name Elam im Namen
der Provinz Ilam und ihrer
gleichnamigen Hauptstadt bewahrt. Der
irakische Diktator Saddam Hussein
(1937 - 2006) wollte die rohstoffreiche iranische Provinz Khuzistan seinem
Machtbereich einverleiben und brach deshalb den 1. Golfkrieg (1980
-1988) vom Zaun. Ideologisch begründet wurde der Angriffskrieg mit
der 'Befreiung Arabistans', d.
h. der schiitischen arabischen Minderheit im Iran.
|
 |

|
Direkt
unterhalb des Château de Suse wurde ein Museum eingerichtet, das sowohl
Fundstücke aus Susa als auch aus der gesamten Region Susiana beherbergt (Foto
links). Begrüsst wird der Museumsbesucher von einem Fragment eines
Stierkapitells, welches während der Achämenidenzeit ein
Säule der Pforte zur Apadama gekrönt hatte (Foto rechts).
|
 |
 |
Keramikgefäß
Proto-Elamische Zeit
4500 - 4000 v. Chr.
Tepe Bandebal
|
Keramikgefäß
Susa I.
um 4000 v . Chr.
Susa, 'Akropolis' II.
|
 |
 |
 |
Keramikgefäß
Proto-Elamische Zeit
4500 - 4000 v. Chr.
Fundort?
|
Keramikgefäß
Proto-Elamische Zeit
4500 - 4000 v. Chr.
Fundort?
|
Keramikgefäß
Susa I.
um 4000 v . Chr.
Susa, 'Akropolis' II. |
 |
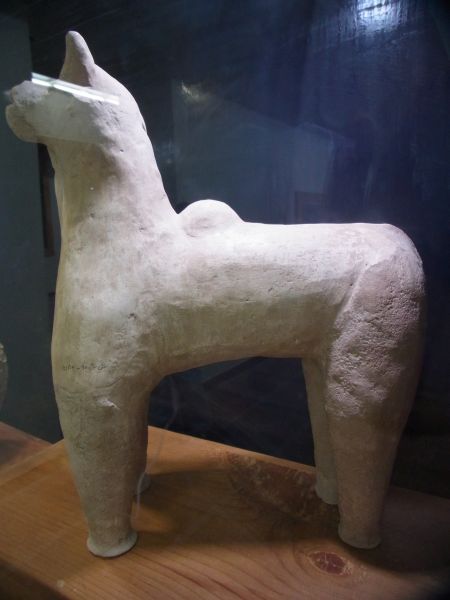 |
 |
Keramikvasen
Mittel-Elamische Zeit
1900 - 1100 v. Chr.
Haft Tepe (Sieben Hügel)
|
|
|
 |
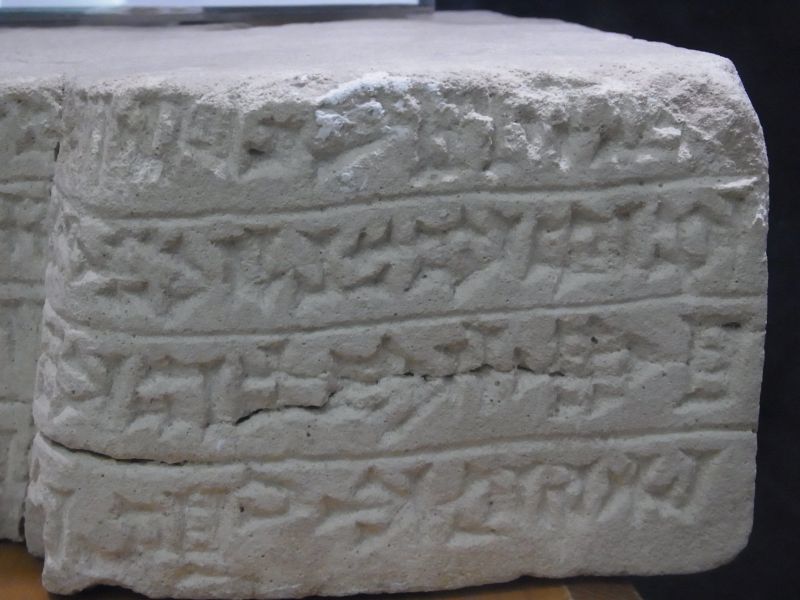 |
Das
Steingefäß entspricht dem frühen
Schriftzeichen 'GA' (Milch)
Proto-Elamische Zeit
um 3300 v. Chr
Susa
|
Die sumerische
Keilschrift war bereits in Alt-Elamischer Zeit von den Elamern
adaptiert worden und hatte die bisher gebräuchliche proto-
elamitische Strichschrift abgelöst. Nach weiteren Modifkationen
fand die elamische Version der Keilschrift bis in die
hellenistische Zeit Verwendung.
|
 |
 |
 |
Frauenporträt
24 cm hoch
|
Maske
20 cm hoch |
Kopf [des
Königs Tepti-Ahar? - Bauherr von Haft Tepe; um 1400 v. Chr.] 28 cm
hoch |
| Alle
drei in Haft Tepe gefundenen Artefakte wurden aus ungebranntem Ton
gefertigt.. |
|
 |
 |
...
und
stammen wie die Rollsiegel aus der Mittel-Elamischen Zeit. Das
Stempelsiegel (Foto rechts)....
|
 |
 |
...und
die Figurinen...
|
|
|
 |
 |
....ebenso
wie die aus Keramik gefertigten Dreifüsse und die verschiedenen
Spielsteine....
|
 |
 |
.... auf
das zweite vorchristliche Jahrtausend datiert.
|
 |
 |
Die
Bronzeplakette mit Hirschmotiven stammt aus Alt-Elamischer Zeit, der
Teil eines Bronzezaunes .....
|
 |
 |
... und
bronzenen militärischen Waffen und
Ausrüstungsgegenstände aus der Mittel-Elamischen Epoche
Luristans.
|
 |
 |
Der
geflügelte Stier (Foto links) und die Abbildung eines
Bogenschützen (Foto rechts) zierten einst die Wände des
Achämenidischen Palastes .
Die Originale der Emailziegelfassaden
sind heute im Pariser Louvre zu sehen.
|
 |
 |
| Glasierte
Keramik (Foto rechts) und Fragmente aus der Achämenidenzeit (559
v. Chr. -
330 v. Chr.) |
 |
 |
| Die
Figurinenfragmente und die Öllampen aus Keramik... |
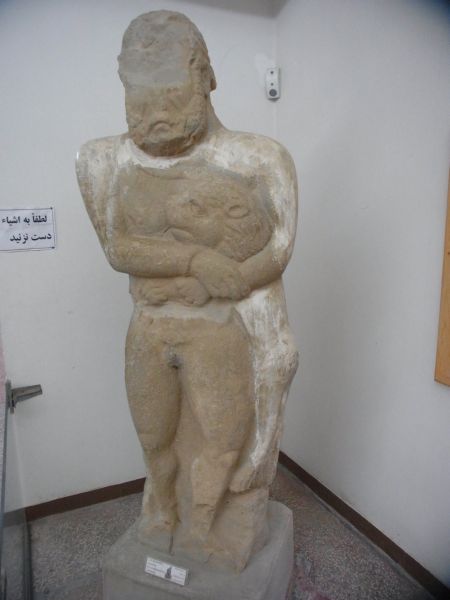 |
 |
...
stammen wie die Herkulesstatue und der Steinzylinder mit Relief aus dem
Mittel-Persischen Reich der Parther (250 v. Chr- 224 n. Chr.)
|
 |
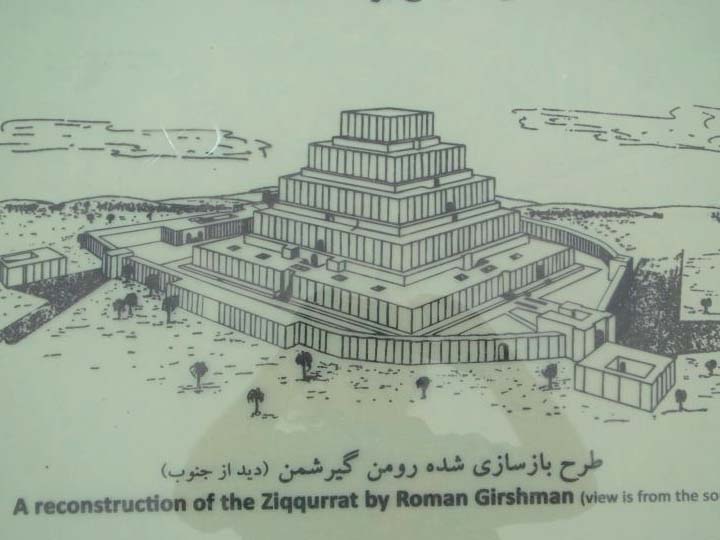 |
Ca. 40 km
südöstlich von Susa befindet sich die Reste der
Mittel-Elamischen Tempelstadt Dur-Untasch
(heute Chogha Zanbil). Im
Zentrum der von König Untasch-Napirischa
(1275 - 1240 v. Chr.) gegründeten Residenz stand eine gewaltige
Zikkurat (= babylon. 'hoch aufragend'), die den künstlichen
mesopotamischen Stufentürmen nachempfunden war. Obgleich von der
ursprünglich ca. 50 hohen Zikkurat nur noch ein halb so hoher Rest
erhalten geblieben ist, stellt sie einer Seitenlängen von 105
Meter [und ihrer Wiederherstellung nach dem Ersten Golfkrieg] die
besterhaltenste Mesopotamiens und die bisher älteste in Elam
gefundene dar. Sie bestand aus einem Hochtempel auf vier Terrassen und
war den Göttern Inšušinak
und Napirischa geweiht.
|
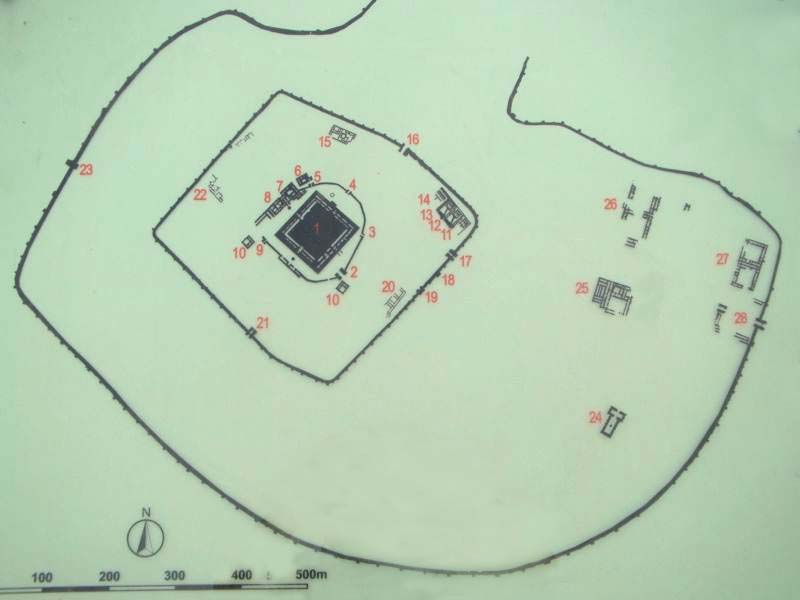 |
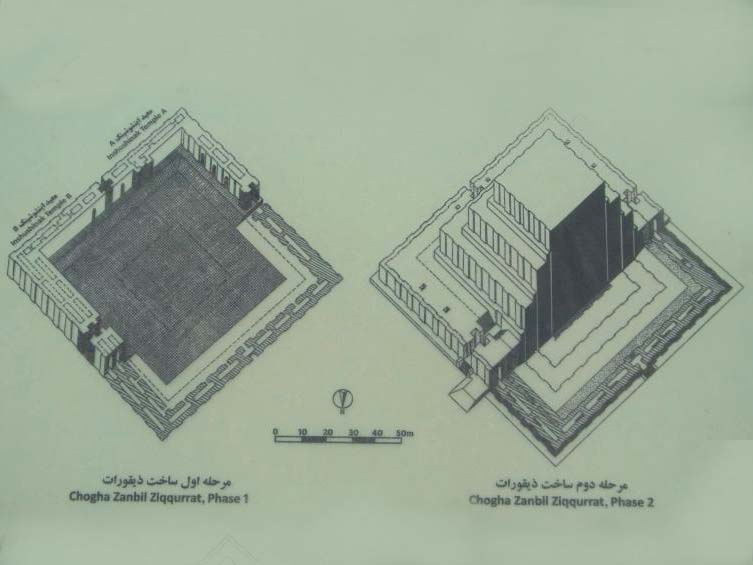 |
Das
insgesamt etwa 100 ha umfassende Stadtgebiet war von einer mehr als 4
Kilometer langen Mauer umgeben. Im Zentrum des Stadtgebietes lag
der wiederum von einer Mauer umfriedete 470 x 380 Meter
große 'Heilige Bezirk'.
Während die Zikkurats des Zweistromlandes aus horizontal
errichteten und jeweils aufeinandergestellten, nach oben hin kleiner
werdenden Terrassen aufgebaut wurden, bestand die Konstruktion des
'Götterberges von Chogha Zanbil' aus einem turmartigen Kern in der
Mitte, der von jeweils niedriger werdenden, ebenfalls auf dem Boden
stehenden Schalen umgeben war.
|
 |
 |
Nachdem
man das südöstlich Tore zum 'Heiligen Bezirk' passiert hat,
kommt man zu den Fundamenten von Tempeln, die hier für mehrere
Götter errichtet worden waren. Unter anderem für
die Göttermutter [!] Pinekir,
die bis ins 2. Jahrtausend v. Chr. an der Spitze des elamischen
Pantheons gestanden hatte. Einige Zeitgenossinnen, wie die
schweizer Psychologin Doris Wolf in ihrem Buch Der Kampf gegen
Weisheit und Macht der matriarchalen Urkultur Ägyptens vertreten
die These, dass die Elamer anfangs in einem Matriachat gelebt hätten.
|
 |
 |
| An der
Südosttseite der Zikkurat befanden sich zwei Heiligtümern des Gottes Inšušinak (sumerisch: Herr von
Susa), dem auch die ganze Zikkurat geweiht gewesen war.
Im Vordergrund (Bild links) ist der Zugang zum Inuschinak-Tempel B zu
sehen, weiter hinten vor dem größeren Zugang, befindet sich
der Opferplatz mit seinem Ziegelsockel für die Schlachtopfer. Das
rechte Foto zeigt den Blick in die entgegengesetzte Richtung. Der
für fast alle Epochen Elams bezeugte Inšušinak
(Inschuschinak) war Gott der Unterwelt und Totenrichter. Die Elamer
glaubten an ein jenseitiges Leben und verfügten daher in ihren
Testamenten, dass sie nach ihrem Tode mit Grabopfern und Trankspenden
versorgt wurden. Als sakraler urkundlicher Garant wurde
hierzu Inšušinak hinzugezogen. |
 |
 |
Vor dem
größeren Zugang an der Südwestseite befinden sich zwei
Reihen mit jeweils sieben Opfertischen. Vor der
Südwest-Treppe (Foto rechts)....
|
 |
 |
...wurde
aus mit Keilschrift versehenen Ziegeln (verzeichnisse der Opfergaben)
ein runder Opferaltar mit Scheinfenstern errichtet.
|
 |
 |
Die
Nordöstliche Ecke der Zikkurat (Foto links) . An der
nordöstlichen Treppe befindet sich eine Plattform, die zur
Durchführung von Ritualen, wie beispielsweise 'Priesterweihen'
genutzt wurde. An dieser Stelle wurden auch die Fragmente einer
Bullenstatue mit der Inschrift des Königs Untasch-Napirischa
(Untasch-GAL) gefunden.
|