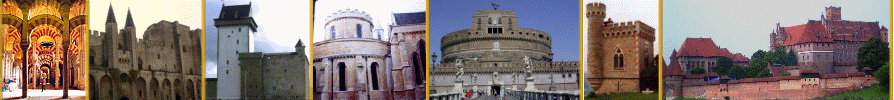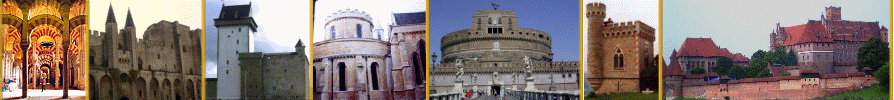|
 |
Etwa 10
Kilometer nordwestlich der für ihre Teppiche bekannten Stadt
Malāyer (Provinz) Hamadan befindet sich der Tepe Nush-e Jan, der einst von einer
Festung der Meder gekrönt gewesen war. Die von britischen
Archäologen freigelegte Anlage weist lediglich eine
Besiedlungsphase für einen Zeit- raum von vor 700 v. Chr. bis c.
550 v. Chr. vor. Nach einem Aufstieg auf den 37 Meter hohen,
natürlichen Hügel gelangt man zunächst an den
Eingang der unter einem Schutzdach stehenden einstigen Festung.
|
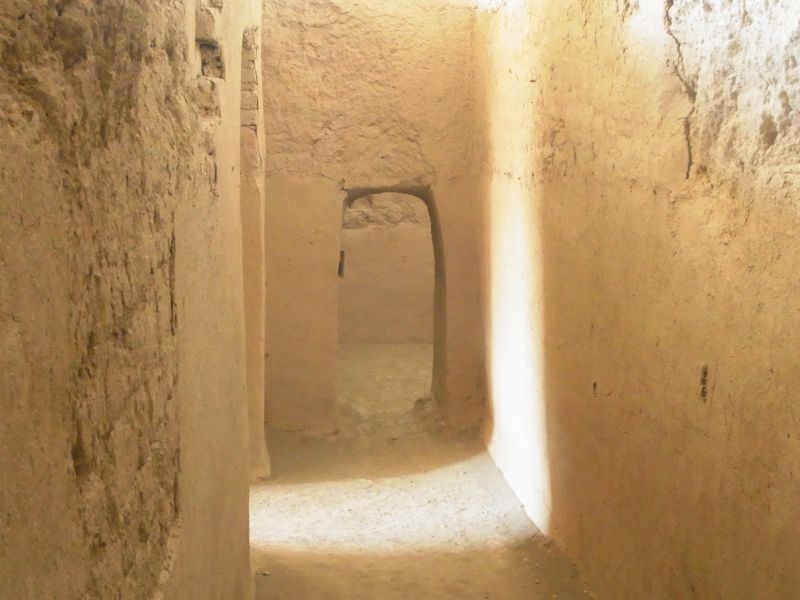 |
 |
Im
Inneren der aus ungebrannten Ziegeln errichteten Zitadelle, zu der
mehrere Lagerräume gehören.
|
 |
 |
Videoclip: Panoramablick vom Tepe Nush-e Jan
|
Als Meder
(altpersisch Māda, babylonisch Umman-Mand, griechisch Μηδία) wurden im
Altertum die Bewohner des westlichen Irans bezeichnet, die wiederholt
wechselnde Konföderationen eingingen. Obgleich der Begriff Meder
keine konkrete Volksbezeichnung war, da mitunter auch Kimmerier und
Skythen so genannt wurden, waren ihre Völkerschaften
indeoeuropäischen Ursprungs und mit den antiken Persern eng
verwandt. Einen zusammen- hängenden Staat, bzw. ein
'Königreich Medien' hat es nicht gegeben. Vielmehr handelte es
sich um Kleinstfürstentümer, die sich aus mehr als 100
Stammesverbänden zusammensetzten und unter Kyaxares I. (Reg. 768 - 715 v.
Chr.), der seine Residenz in Ekbatana (heute Hamadan) nahm, zu einer
militärischen Einheit verbündeten. Wechselnde
Bündnispartner und die mehr oder weniger starke Herrschaft der
Skythen, von denen die Meder das Reiten und Bogenschießen
erlernten, veränderten wiederholt die territorialen Strukturen der
medischen Konföderation.
|
An der südlichen Mauer der Festung entlang (Foto
rechts.....
|
 |
 |
.....und
Foto links) gelangt man zum einstigen Zentraltempel
(Foto rechts).
|
Nachdem Kyaxares II. (um 625 – 584 v. Chr.)
die Skythenherrschaft
abschütteln konnte, erreichte die medische Konföderation
durch weitere
militärische Expansionen ihre größte Ausdehnung. In
einem Bündnis mit
Babylon zerschlugen die Meder im Jahr 614 v. Chr. in das Reich Assyrien
und zerstörten die Stadt Assur. 612 v. Chr. eroberten die
Meder
schließlich auch die assyrische Hauptstadt Niniveh.
Nachdem sich der
medische Adel 553 v. Chr. mit den Persern verbündet hatte, wurde
die
Meder-Konföderation von Kyros II. unterworfen, der damit den
Grundstein
für das Achämenidenreich legte. Medien wurde zu einer
Satrapie des
Altpersischen Reiches und musste dem Großkönig
alljährlichen Tribut
leisten. Dennoch genoss die medische Aristokratie ein hohes Maß
an
Privilegien und wurde an der Verwaltung des Reiches beteiligt. Wie es
das 'Menetekel' des Buches Daniel, Kapitel 5, Vers 1–25 im Alten
Testament prophezeite, sollte das Neubabylonische Reich gemeinsam von Medern und Persern
zerstört werden, deren Großkönig Kyros II. am 6.
Oktober 539 v. Chr. in Babylon einzog. Auch im Hinblick auf die
achämenidischen
Reliefdarstellungen, insbesondere der 'Delegation der
Völkerschaften'
in Persepolis, gewinnt man den Eindruck, dass die Meder den Persern
beinahe gleichgestellt waren.
|
 |
 |
Die
Innenwände des kreuzförmig angelegten Zentraltempels mit
ihren Nischen, Scheinfenstern....
|
 |
 |
....und
doppelten 'Zahnreigen' aus Ziegeln wurden zum Teil rekonstruiert. Der
Sakralbau gilt mit dem darin vorgefundenen 'Feuerheiligtum' als älteste, bisher
bekannte Manifestation des Zoroastrismus. Die ehemalige, 20 x 16
Meter große Säulenhalle und das 'Westliche Gebäude'
schließen sich an den 'Feuertempel' an (Foto rechts).
|
 |
 |
Auf einer
Anhöhe am Stadtrand von Hamadan
steht die stark verwitterte
Löwenskulpur (Sang-e Shir). Über den Ursprung des
heute beinahe beinlosen, 2,50 langen Standbildes herrscht Uneinigkeit.
Während er in der Wissenschaft sowohl als medisch als auch
achämenidisch und parthisch angesehen wird, berichtet eine Legende
davon, dass er von Alexander dem Großen zu Ehren seines
gefallenen generals Hephaistion in Auftrag gegeben worden sei. Der
ursprüngliche Standort des Löwen ist nicht bekannt, man
weiß nur, dass er sich in frühislamischer Zeit mit einem
heute verschollenen, ähnlich gestalteten Pendant an einem der
Stadttore, dem Bab al-Asad (Löwentor) befand.
|
 |
 |
In
achämenidischer Zeit war Hagmatana
(Hamadan), das von den Griechen als Ekbatana bezeichnet wurde, neben
Susa und Persepolis eine Verwaltungshauptstadt des Reiches. Danach
diente es in parthischer und sassanidischer Zeit als Sommerresidenz der
Herrscher. Etwa 12 Kilometer südwestlich der auf einer
Höhe von 1850 Metern über NN gelegenen Stadt befindet sich
das Erholungs- und Sportgebiet Gandj
Nameh.
|
 |
 |
| Vorbei an
den überall präsenten Flaggen der Islamischen Republik Iran
und einem, dem Spiralminarett der großen Moschee von Samarra
(Irak) nachempfundenen Brunnen (Foto rechts) vorbei..... |
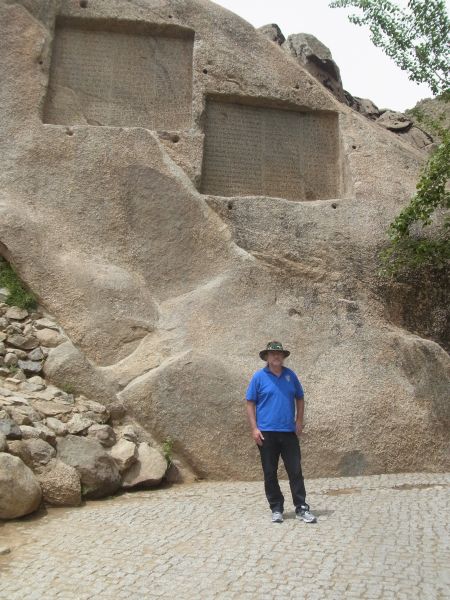 |
 |
...gelangt
man zu einem achämenidischen Denkmal, das dem Ort seinen Namen
verliehen hat. Gandj Nameh
(Schatzbuch) werden zwei in den Felsen geschlagene Inschriften
genannt. Die beiden Inschriftenfelder bestehen jeweils aus drei
vertikalen, 20 Zeilen umfassenden Rubriken....
|
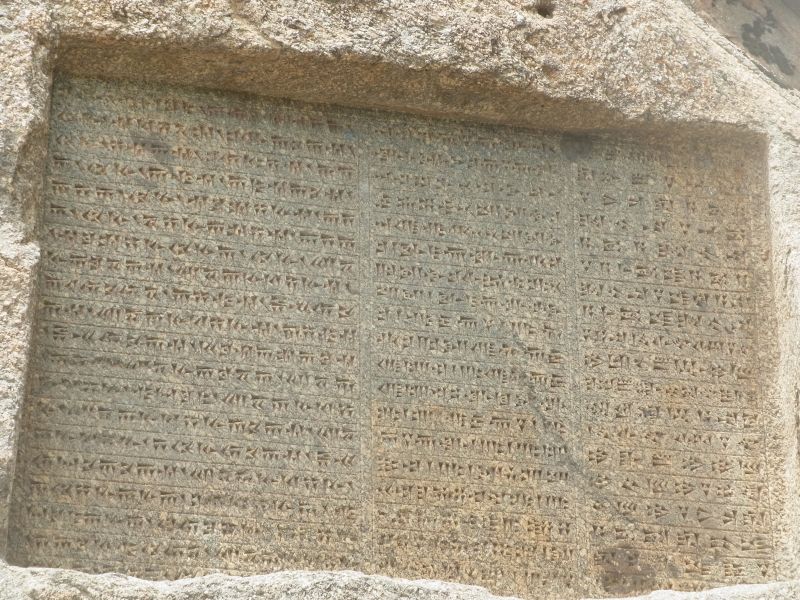 |
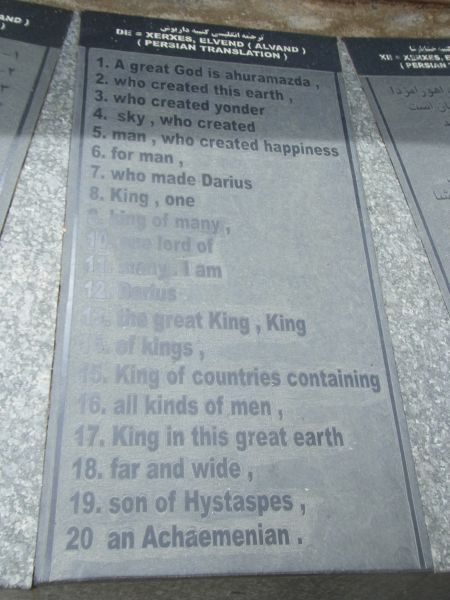 |
...die
als Keilschrift-Trilinguen in
Altpersisch, Neulelamisch und Neubabylonisch, den drei
Verwaltungsspachen des Achämenidenreiches, verfasst wurden.
Das linke Inschriftenfeld stammt von Dareios
I. (522 - 486 v. Chr.), das rechte (Foto links) von seinem Sohn Xerxes (486 - 465). Beide
sind eine Huldigung an den Gott Ahura Mazda und eine genealogische
Darstellung. Die englische Übersetzung des Dareios-Textes (Foto
rechts). Gandj Nameh ist heute ein
Treffpunkt der relativ großen jüdischen Gemeinde von
Hamadan, die ihren Ursprung auf die biblische Esther, die Gemahlin von
Xerxes I. zurückführt.
|
 |
 |
Etwa 170
Kilometer südwestlich von Hamadan, 30 Kilometer vor Kermansha, der
Hauptstadt der gleichnamigen Provinz, beim Dorf Bisotun (auch:
Bistun/Bisutun/Behistun/Behistan), befindet
sich der 'Berg der Götter'.
Das steile Felsmassiv mit einer Reihe von Reliefs aus unterschiedlichen
Epochen wurde im Jahre 2006 in die Liste des UNESCO-Weltkulturerbe aufgenommen.
Begrüsst wird der Besucher von einer beinahe Vollplastik des
lagernden Herakles aus
seleukidischer Zeit, der auch als eine Verkörperung der alt-iranischen Gottheit Verethragna
angesehen wurde. Das nach seiner Inschrift auf 148 v. Chr. zu
datierende Bildnis zeigt den Heros unter einem Olivenbaum und auf einem
Löwenfell liegend, mit einem Trinkgefäß in der linken
Hand.
|
 |
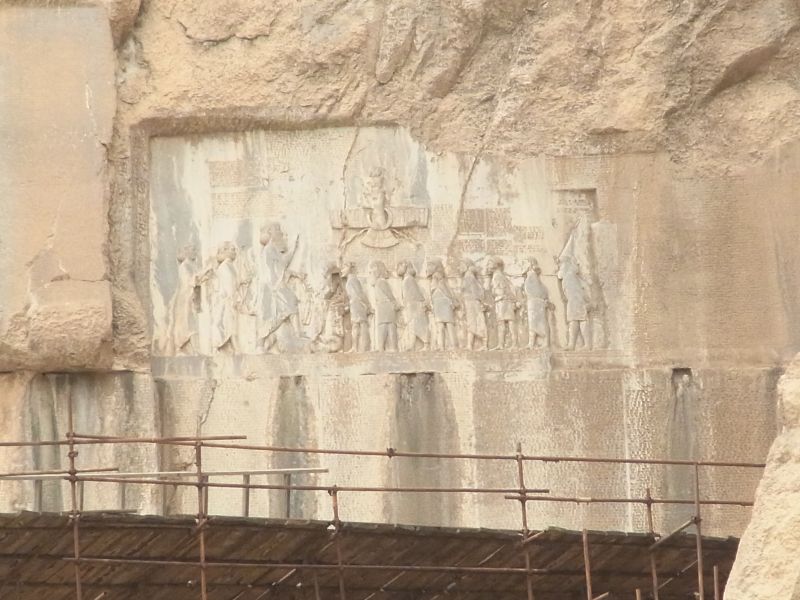 |
Das
bedeutendste Artefakt von Bisotun stellt jedoch ein Relief mit einer
dreisprachigen Inschrift dar, die Dareios I. oberhalb einer Quelle im
Felsen anbringen ließ. Die von der Wand kopierte Trilingue
ermöglichte dem britischen Archäologen, Assyriologen und
Diplomaten Sir Henry Creswicke Rawlinson (1810- 1895) im Jahre 1846 die
Entzifferung der Keilschrift. Das Relief ist etwa 5,5 Meter breit und
gut drei Meter hoch. Es zeigt Dareios I., der seinen Fuß auf
seinen am Boden liegenden Gegner Gaumata gesetzt hat. Nachdem
Großkönig Kambyses II.
(Reg. 530 - 522 v. Chr.) auf dem Rückweg eines
Ägyptenfeldzuges infolge eines Unfalls verstorben war, hatte sich Gaumata mit neun Satrapen des
Reiches zusammengeschlossen und den Thron der Achämeniden
usurpiert. Dareios, ein
Offizier und entfernter Verwandter des Kambyses II., konnte den
Usurpator und seine Verbündeten, die auf dem Relief als aneinander
gekettete 'Lügenkönige' dargestellt sind, besiegen, sich
selbst als 9. Achämenidenherrscher auf den Thron setzten und deren
Dynastiezweig Teispes/Ariaramna I. begründen. Durch den über
die Szene schwebenden Faravahar sollte die Königswürde des
Dareios durch Ahura Mazda legitimiert werden. Mittlerweile wird es in
Forschung jedoch auch für möglich erachtet, dass Gaumata in
Wirklichkeit Bardiya (Reg. 522
v. Chr.), der jüngere Bruder des Kambyses gewesen ist. In diesem
Fall wäre die Darstellung des Dareios nur die Rechtfertigung
für seine eigene Usurpation.
|
 |

|
Die ca.
400 westlich des Dareios-Reliefs befindliche, 200 x 30 Meter
große glatte Wand (Farhad Tarash)
war vermutlich für ein Kolossalrelief des Sassanidenherrschers Chosrau II. (Reg. 590 - 628) aus dem
Fels geschlagen worden. Das stark verwitterte Relief des parthischen
Königs Gotarzes II. (Reg.
38 bis 51 n. Chr.) musste zum Teil einer Waqf (frommen Stiftung) von
Sheyk Ali Khan Zanganeh, dem kurdischstämmigen Großwesir des
safawidischen Schahs Safi II. (Reg. 1666 - 1694), weichen (Foto
rechts).
|
 |

|
Während
sich aufgrund von Ablagerungen in mehreren natürlichen Höhlen
des 'Berges der Götter bereits' eine Besiedlung während des
Mittleren Paläolithikums (40.000 - 35.000 v. Chr.) nachweisen
lässt, stammen die Neue
Karawanserei (Foto links) und die 115 lange Brücke aus der Safawidenzeit.
|
 |
 |
Vier
Kilometer nördöstlich der Provinzhauptstadt Kermansha
befindet sich mit Taq-e Bostan
eine weitere Weltkulturerbestätte, die im Jahre 2007 in die
UNESCO-Liste aufgenommen wurde. Die an einem künstlichen See
gelegene Anlage gehörte einstmals zu einem sassanidischen
Paradeisos (von avestisch pairi-daēza = umgrenzter Bereich).
Forschungen haben ergeben dass der Platz bereits zur Parther-Zeit (250
v. Chr- 224 n. Chr.) bereits als Gartenalage genutzt worden war. Zwei
unterschiedlich große, in den Felsen gehauene Bogennischen, die
auch als Iwane oder Grotten bezeichnet werden, sind jedoch mit einem
weiteren Relief die feinsten und am besten erhaltenen Beispiele der
persischen Skulptur aus der Zeit der Sassaniden (224 -
642 n. Chr).
Die Rückwand des großen Iwans (Foto rechts) ist zweigeteilt.
Der abgerundete obere Bereich zeigt die Investitur von Chosrau II. (591-628).
|
 |
 |
| Im
unteren Bereich befindet sich eine nahezu vollplastische Reiterfigur Chosraus II. (
590 bis 628) auf seinem Lieblingsschlachtross Schabdiz.
Über 1300 Jahren nach den Sassaniden wurde auf der linken Seite
des Bogens ein noch teilweise farbiges Relief des Qadscharen Fath Ali Schah (Reg.
1797 - 1834) eingemeißelt. Der äußere Teil des Iwans
ist mit Engeln und einem Baum verziert, welcher den Lebensbaum oder den
heiligen Baum verkörpert. |
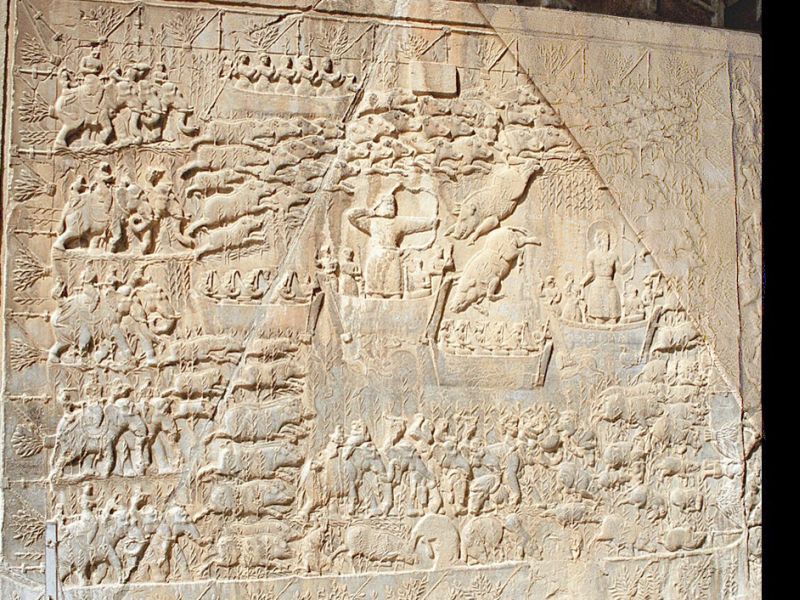
|
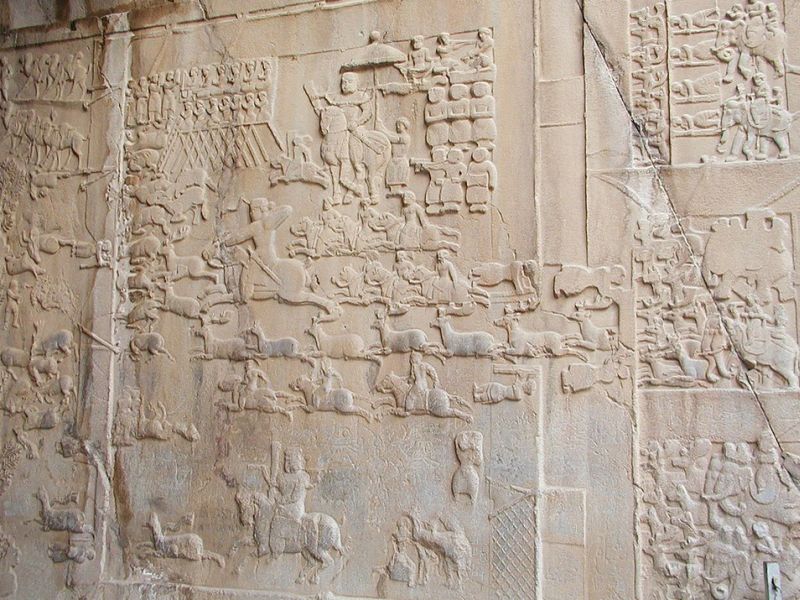 |
Im ihrem
unteren Bereich der beiden Seitenwände in der großen
Bogennische ist Chosrau jeweils in dem Relief einer Eberjagd (Foto
links) und dem einer Hirschjagd (Foto rechts) zu sehen. Da die Jagd
seit Kyros II. zu den beliebtesten Beschäftigungen der persischen
Könige zählte, findet man diese Sinnbilder von Kraft und
Vitalität häufig neben den Reliefs von Investituren.
|
 |
 |
| Die
Investiturszene zeigt den von Ahura
Mazda und Anahita
flankierten Chosrau II,
der aus den Händen von Gott und Göttin jeweils einen 'Ring
der Macht' und damit die Legitimation seines Königtums
erhält. Das kolossale Reiterbildnis ist 7,45 Meter breit und 4,25
Meter hoch. Voll gepanzert mit Schild
und Lanze ist der sassanidische Reiter (Kataphrakt) und sein
Schlachtross die
Blaupause für die abendländischen Ritter des
Hochmittelalters. Ebenso, wie die sassanidische Dichtung zur Vorlage
der Ritterepen wie dem Parzival und dem 'Minnesang' werden sollte. |
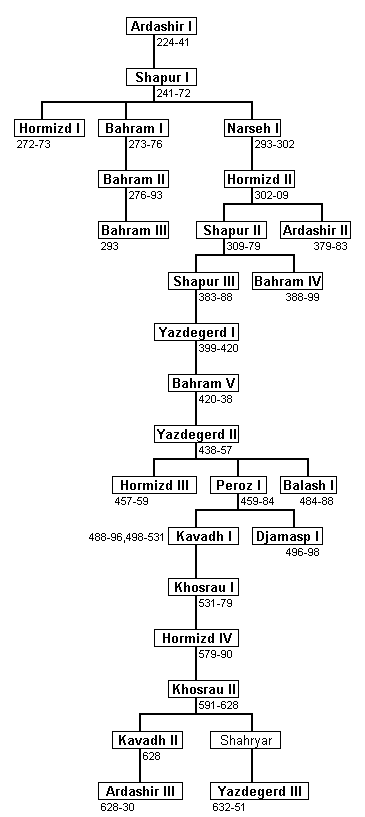
|

|
Stammbaum
der Sassaniden & und Reenactor eines sassanidischen Kataphrakten
des 3. Jahrhunderts n. Chr mit Bar-gustuwān (Pferdepanzerung) aus Wikipedia
|
Chosrou Parwiz (der Sieger), wie er
auch genannt wurde, war der letzte bedeutende Großkönig der
Sassaniden. Nachdem er mit seinen Truppen im Frühjahr 611 den
Euphrat überschritten hatte, eilte er von Sieg zu Sieg. Seine
Generäle Schahin und Shahrbaraz eroberten bis 619 Syrien und
Ägypten, die dauerhaft in das Reich eingegliedert werden sollten.
Auch Kleinasien wurde geplündert und das Heilige Kreuz 614 von Jerusalem nach
Ktesiphon gebracht. Es schien so, als sei das alte
Achämenidenreich wieder erwacht und das Ende von Byzanz gekommen.
Doch der byzantinischen Kaiser Herakleios (Reg. 610 - 641) , der
die Verteidigung seines Reiches zum 'Heiligen Krieg' erklärt
hatte, konnte tief in den persischen Herrschaftsraum eindringen und die
persischen Armeen in mehreren Schlachten besiegen. Zeitlich synchron
zur Niederlage der Perser in der Schlacht bei Niniveh im Dezember 627
griffen die Göktürken den Osten des Sassanidenreiches an,
wodurch Persien in einen Zweifrontenkrieg verwickelt wurde. Chosrau
floh panikartig von seiner Lieblingsresidenz Dastagird nach Ktesiphon,
wo er abgesetzt, ins Gefängnis geworfen und nach nach vier Tagen
ermordet wurde. Als besonders folgenschwerer Fehler Chosraus II.
sollte sich jedoch die Auflösung des des Pufferstaates der
Lachmiden erweisen, der bis dahin das Neupersische Reich die Sicherung
gegenüber Arabien übernommen hatte.
|
 |
 |
| In der
kleineren, etwa 6 x 5 x 3,6 großen Bogennische ließ sich Shapur III. (Reg. 383 - 388), der
zur Durchsetzung seines Thronrechtes hart kämpfen musste, zur
Legitimation seines Herrschaftsanspruches neben seinem erfolgreichen
und langlebigen Vater [Großvater?], Shapur II. (Reg. 309 - 379),
abbilden. Beide Könige sind etwa 3 m groß, wobei Shapur
II. rechts und Shapur III. links steht. Während ihre
Hände jeweils auf dem Knauf und dem Griff eines Langschwertes
ruhen, tragen beide Figuren lose Hosen, Halsketten, lockige Haare und
einen Spitzbart. Das älteste Relief ist die 4,07 x
3,90 große Investiturszene von
Ardashir II. (Reg. 379–383), die rechts neben der kleineren
Nische befindet (Foto rechts). |
 |
| In der
Mitte der Szene steht Ardaschir II., der von Ahura Mazda
den Ring als Symbol königlicher Macht erhält. Hinter Ardashir
steht
Mithras, der den König symbolisch mit einem Schwert schützt.
Die unter
Ardashir II. liegende Figur stellt einen besiegten Römer,
möglicherweise sogar Kaiser Julian Flavius Claudius Iulianus (Reg.
360
- 363) dar, der im Westen von den Christen aufgrund seiner Versuche zur
Wiederherstellung der alten griechisch-römischen Religion als
Iulianus
Apostata (Julian der Abtrünnige), bezeichnet wurde. Mithras
trägt nicht
nur die Strahlenkrone des 'Sol Invictus', sondern steht auch
[ähnlich wie bei den Darstellungen Buddhas] auf einer
Lotosblüte! |
|